Leseprobe
Uhrzeit und Frühgeschichte
Wie es begann
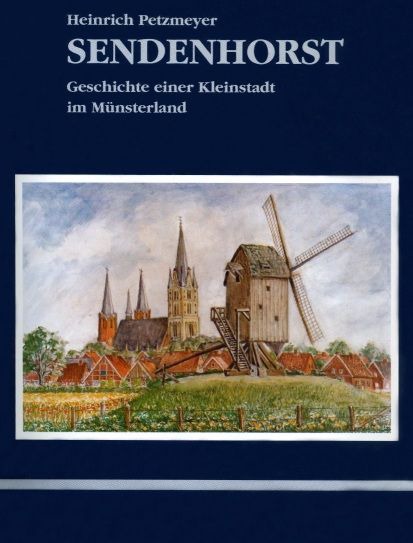 Geschichte will zu den Anfängen führen, will zeigen, wie es begann. Auch wenn der erste Sendenhorster nicht in
Neandertalerzeiten zurückreicht, so mag es nützlich und sinnvoll sein, einige vorgeschichtliche Informationen an den Anfang zu stellen. Adam kommt aus Afrika. In dem schwarzen Erdteil wurden die
frühesten, eine Million Jahre alten Menschenspuren gefunden.
Geschichte will zu den Anfängen führen, will zeigen, wie es begann. Auch wenn der erste Sendenhorster nicht in
Neandertalerzeiten zurückreicht, so mag es nützlich und sinnvoll sein, einige vorgeschichtliche Informationen an den Anfang zu stellen. Adam kommt aus Afrika. In dem schwarzen Erdteil wurden die
frühesten, eine Million Jahre alten Menschenspuren gefunden.
Die ältesten Europäer sind 500.000 Jahre jünger. Ihre Spuren fanden sich bei Heidelberg. Der älteste Westfale vom Stamme der Neandertaler lebte vor 80.000 Jahren in den Balver Höhlen im
sauerländischen Hönnetal. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Urmenschheit drei Eiszeiten und drei Warmzeiten durchlebt. Zunächst kühlte das Klima über einen Zeitraum von Tausenden von Jahren ab. Die
Gletscher Nordeuropas, der Alpen und der Pyrenäen erstreckten sich über beinahe ganz Mitteleuropa. Auf einem schmalen, eisfreien Streifen zwischen Donau und Mittelgebirge jagten die eiszeitlichen
Menschen Mammut, Wollnashorn und Rentier.
Dann wurde es wieder wärmer. Die Gletscher schmolzen. Die Schmelzwasser sammelten sich in den »Urstromtälern« zu reißenden Flüssen, rissen tiefe Furchen und Abgründe in die Landschaft und gruben
tiefe Schluchten in die norddeutsche Tieflandbucht. Einer dieser eiszeitlichen Carions verlief vom heutigen
11
Greven über Münster und Sendenhorst bis Ennigerloh. Eine weitere Eiszeit ging ins Land. Die Schmelzrückstände der Gletscher, Grobsand und Kies, füllten die Rinnen des Urstroms und schufen im
Kernmünsterland einen ungefähr 80 km langen und bis zu einen Kilometer breiten Kiessandrücken, den »Uppenberger Geestrücken«1. Vor rund 10.000 Jahren ging die vorläufig letzte Eiszeit ihrem Ende zu.
Birken- und Kiefernwälder verdrängten die Tundra. Ihnen folgten Eichen, Linden und Ulmen.
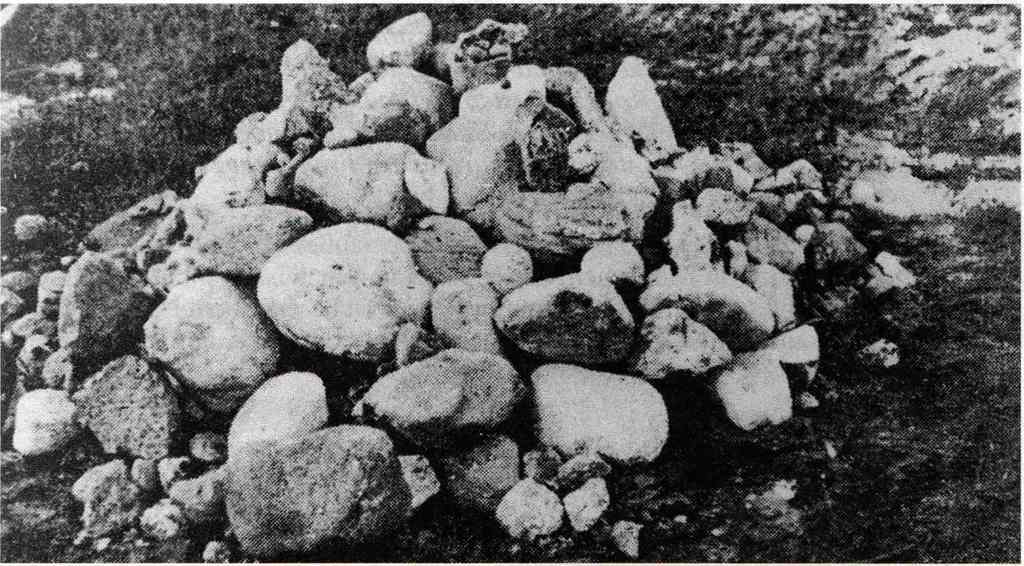
Bild:
Zeugen der Eiszeit: Nordische Gesteine, gefunden in einer Sandgrube auf der Hardt
Noch war der Mensch nicht seßhaft geworden, lebte ausschließlich von der Jagd und vom Sammeln. Auf der ständigen Suche nach Nahrung durchstreiften mittelsteinzeitliche Horden die weiten Ebenen des
norddeutschen Tieflandes. In dieser Zeit, um 8.000 v. Chr., müssen die ersten Menschen das Gebiet der heutigen Stadt Sendenhorst betreten haben. Die dichten Eichen-, Birken- und Buchenwälder
meidend, streiften die Jäger- und Sammlerhorden an den Ufern der Bäche und Flüsse entlang. Selbst kleine Rinnsale hatten eine durch häufige Überschwemmungen baumfreie Uferzone. In der Helmbachaue,
auf der Grenze nach Albersloh, auf der Uferkante des Baches, hat eine steinzeitliche Nomadenhorde vor 8.000-10.000 Jahren ein Feuer entzündet, um die Jagdbeute zu braten oder sich vor Kälte zu
schützen2)
Die Jungsteinzeit
1933 deckten Mitglieder des freiwilligen Arbeitsdienstes, der mit der Helmbachregulierung beschäftigt war, die Feuerstelle auf. Der aktuellen Wertschätzung »germanischer« Bodenfunde entsprechend,
brachte die »Glocke am Sonntag« einen dreispaltigen Bericht:
Ein Arbeitslager macht vor- und frühgeschichtliche Ausgrabungen. Ein Bericht über die vorlliujigen Ergebnisse von Junglehrer Willi Dege z. Zt. Freiwilliger im Arbeitslager Sendtmhorst. ...Etwa 50-70
cm unter der Erdoberfläche stießen wir auf grünlich-braune schwere Schlacke von eisenhaltigem Sand und darauf Holzkohlestückchen, Knochensplitter und ein wunderbar gearbeitetes Steinbeil mit
vierkantigem Rücken. Alle Funde waren mit einer tonigen Schlammschicht überdeckt, ein Zeichen dafür, daß die Feuerstelle durch ein Hochwasser zerstört worden war Das bewiesen auch zahlreiche
Holzkohlestückchen und Knochenreste, die ein Stück weiter abgelagert waren. Unter diesen Knochenresten befand sich auch ein bearbeitetes Stück von 15 cm Länge, es war an einem Ende spitz, am anderen
Ende zu einem Knoten zugeschnitten und hat unseren Steinzeitvorfahren sicher als Pfriem beim Nähen ihrer Fellkleidung gedient.
Die Helmbachfeuerstelle ist ein Zufallsfund, der außer der gesicherten Tatsache der Anwesenheit von Menschen wenig aussagt. Wir wissen nicht, ob Horden Sendenhorster Gebiet regelmäßig durchquerten,
welche Jagdbeute sie machten, ob der Rastplatz am Helmbach ein flüchtiges Tages- oder ein dauerhafteres Sommerquartier war.
12
Jungsteinzeit — der Mensch wird seßhaft
Die Einführung von Ackerbau und Viehzucht war die umwälzendste, folgenreichste Veränderung in der Geschichte der älteren Menschheit. Der Mensch war nicht länger von den Zufälligkeiten der Jagd- oder
Sammelbeute abhängig. Er wurde seßhaft, errichtete feste Gebäude, lernte, Vorratswirtschaft zu betreiben, Ton zu verarbeiten und Kleidung aus Wolle oder Flachs herzustellen.Angefangen hat diese neue
Lebensweise vor 8.000 Jahren in Vorderasien und Ägypten. Erst 2.000 Jahr später lebte in Mitteleuropa ein bodenständiges Bauerntum, die nach den bandförmig verzierten Tongefäßen benannten
»Bandkeramiker«. In Westfalen haben die Bodenforscher in den letzten Jahrzehnten mehrere Wohnplätze der Bandkeramiker entdeckt, ausschließlich auf den fruchtbaren Lösböden des Hellwegs und der
Warburger Börde. Das Münsterland, und damit auch der Sendenhorster Raum, blieb zunächst siedlungsleer. Lange Zeit war die Lippe Trennlinie zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen: jenseits des
Flusses, in der Soester Börde, seßhafte Ackerbauern, diesseits, im Münsterland. nomadisierende Jäger und Sammler'.
Im 3. Jahrtausend vor Christus breitete sich mit der sogenannten Trichterbecherkultur (genannt nach ihren trichterförmigen Tongefäßen) das Bauerntum im Münsterland aus. Der Sendenhorster Raum
scheint jedoch noch gemieden worden zu sein. Nicht Bodenqualität und hohe Erträge, sondern eine leichte Bearbeitung war für die Standortwahl der ersten Siedlungen maßgebend. Und so häufen sich die
Siedlungsfunde im westlichen Münsterland, auf den podsolierten Quarzsandböden und auf den trockenen und schwach lehmigen Sandböden. Das Kernmünsterland blieb bis heute fundleer und damit vermutlich
in der Jungsteinzeit siedlungsleer4. Jedoch ist zu bedenken, daß dieses Bild durch Bodenfunde korrigiert werden kann. Unumstößliche Feststellungen sind in der vorgeschichtlichen Bodenkunde nicht zu
treffen. Aussagen haben nur einen hohen Wahrscheinlichkeitswert. Überraschende
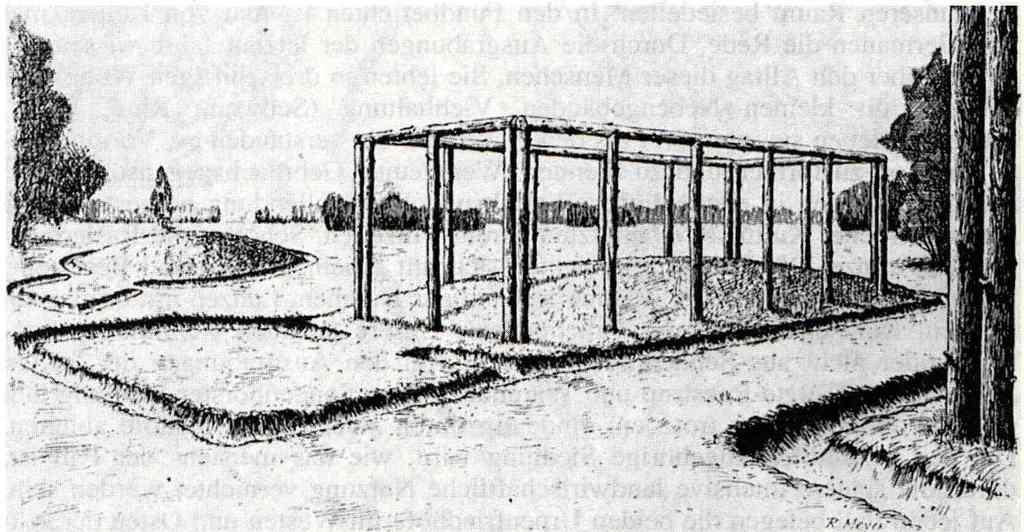 Bild:
Bild:
So könnte der bronzezeitliche Friedhof »Martiniring« zur Zeit seiner Belegung 500 v. Chr. ausgesehen haben (Rekonstruktion jüngerbronzezeitlicher Grabmonumente.
13
Funde können das Bild korrigieren. Aber nicht jeder Lesefund einer Waffe, eines Werkzeugs ist schon ein Beleg für eine steinzeitliche Siedlung.
Obwohl es seither keine Eiszeit mehr gab, schwankte das Klima doch immer wieder in größeren Zeitabständen. Die Wissenschaftler haben den verschiedenen Klimastufen Namen gegeben: Dem warmen, trockenen
Boreal (6000-4000 v. Chr.) folgten 2.000 Jahre mit einem warmen, aber feuchten Klima. In den folgenden 1.000 Jahren wurde es zunehmend kühler und trockener. Um 1000 v. Chr. setzte schließlich die
Periode des Subatlantikum ein. Es wurde kühl, feucht, ungünstig und unwirtlich für menschliche Siedlungen. Ausgerechnet in dieser ungünstigen, unterkühlten Klimaperiode entschlossen sich Menschen,
im Raum Sendenhorst zu siedeln. Die klimatischen Voraussetzungen waren ungünstig, der schwere Sendenhorster Boden nur mit viel Mühe zu bearbeiten. Aber die Siedler hatten keine andere Wahl. Um
800-600 v. Chr., in der ausgehenden Bronzezeit und beginnenden Eisenzeit, waren die Wohnplätze erster Ordnung längst belegt. Seit der älteren Bronzezeit, seit ungefähr 1700 v. Chr., siedelten
Menschen auf den hochwassersicheren Uferstreifen der Ems zwischen Telgte und Warendorf. Die leichten Sandböden im Westen Alberslohs, in der Hohen Wardt, wurden bereits seit tausend Jahren
bearbeitet5. Weil die Bevölkerung wuchs, mußten sich die Menschen für weitere Siedelplätze mit weniger günstigen Standorten zufrieden geben, nicht mehr unbedingt hoch- oder grundwassergeschützt,
nicht mehr in unmittelbarer Nähe von Bach- oder Flußläufen, aber trotzdem mit dem vorhandenen Werkzeug noch zu bearbeiten. Der Kiesrücken zwischen Greven, Münster, Sendenhorst und Ennigerloh bot den
landsuchenden Bauern Acker- und Siedelland zweiter Wahl.
Es ist die Epoche des Übergangs von der jüngeren Bronzezeit zur älteren Eisenzeit. In Kleinasien kämpften die Griechen um Troja. Auf den Hügeln Roms lassen sich Latiner nieder. In Süddeutschland und
Westfrankreich siedeln die Kelten. Leider berichtet keine schriftliche Quelle über die Völker, die zu dieser Zeit unseren Raum besiedelten. In den Fundberichten ist mal von Kelten, mal von Germanen
die Rede. Durch die Ausgrabungen der letzten Jahre wissen wir einiges über den Alltag dieser Menschen. Sie lebten in dreischiffigen Wohnstallhäusern mit kleinen Nebengebäuden. Viehhaltung (Schwein,
Rind, Schaf, Ziege) betrieben sie intensiver als den Ackerbau. Sie verstanden es, Vorratsgefäße aus Ton zu formen und zu brennen. Werkzeuge, Gebrauchsgegenstände und Schmuck wurden in erstaunlicher
Vielfalt und Formvollendung hergestellt. Die Menschen jener Kulturstufe benutzten bereits Pinzetten, Scheren und Rasiermesser aus Bronze. Die Frauen schmückten sich mit Fibeln, Ringen und
Bernsteinketten. Die Bewaffnung der Männer bestand aus Dolchen, Lanzen mit bronzenen Spitzen, Kurzschwertern und Tüllenbeilen6. Unseie genauen Kenntnisse stammen leider nicht aus Sendenhorst,
sondern von den Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte in Telgte-Raestrup und Warendorf.
Erster Beweis einer Siedlung ca. 600 - 500 v. Chr.
Erster indirekter Beweis einer Siedlung: Urnenfriedhöfe ca. 600 - 500 v. Chr. Eine Sendenhorster Siedlung läßt sich nur indirekt, aber trotzdem eindeutig durch zwei Urnenfriedhöfe ableiten. Die den
Friedhöfen zugehörige Siedlung wird, wie das meistens der Fall ist, durch die spätere intensive landwirtschaftliche Nutzung vernichtet worden sein.
Auf jeden Fall belegen die beiden Urnenfriedhöfe im Westen und Osten der späteren Stadt Sendenhorst das Vorhandensein einer bäuerlichen Siedlung für die Zeit 600-500 v. Chr.
14
Urnenfriedhof Spithöverstraße
1930 wurde auf der Westseite der Spithöverstraße, kurz vor der Straße Westtor, eine Baugrube für ein Wohnhaus ausgehoben. Dabei stießen die Arbeiter auf mehrere Tongefäße mit Leichenbrand. Leider
wurde dem Fund keine größere Bedeutung beigemessen. Die Urnen sind verloren gegangen. Eine Fundmeldung unterblieb, so daß wir weder die genaue Anzahl der Urnen noch die näheren Fundumstände kennen.
Aus der Beschreibung von Zeitzeugen ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß ein bronze-eisenzeitlicher Urnenfriedhof freigelegt worden war'.
Urnenfriedhof Martiniring
Besser sind wir über den zweiten Urnenfriedhof unterrichtet, weil hier das Amt für Bodenpflege (Museum für Vor- und Frühgeschichte Münster) rechtzeitig eingeschaltet wurde. 1949 entstand östlich der
Stadt, auf der stadteigenen bzw. kirchlichen Ackerflur »Brink«, die erste Nachkriegssiedlung »Martiniring«. Wie kurz nach dem Kriege üblich, schachteten die künftigen Eigenheimbesitzer die Baugruben
mit Schaufel und Spaten in Eigen- oder Nachbarschaftshilfe aus. Dabei stieß man bei mehreren Häusern 40 bis 80 cm unter der Oberfläche auf Brandurnen, in rotbraunen Sandschichten eingetieft. Die
Funde wurden von Siegfried Gollub (Münster) untersucht und ausgewertet. Die Tageszeitungen berichteten ausführlich'. Eine Fundakte liegt vor. Nach Gollub war das Fundgebiet vor 2.500 Jahren starken
Wassereinflüssen ausgesetzt. Auf einer schmalen Kuppe einer grund- und hochwasserfreien Dünung hatten die Menschen die Urnen mit den Überresten ihrer Verstorbenen beigesetzt. Dem Fundbericht
entnehmen wir:
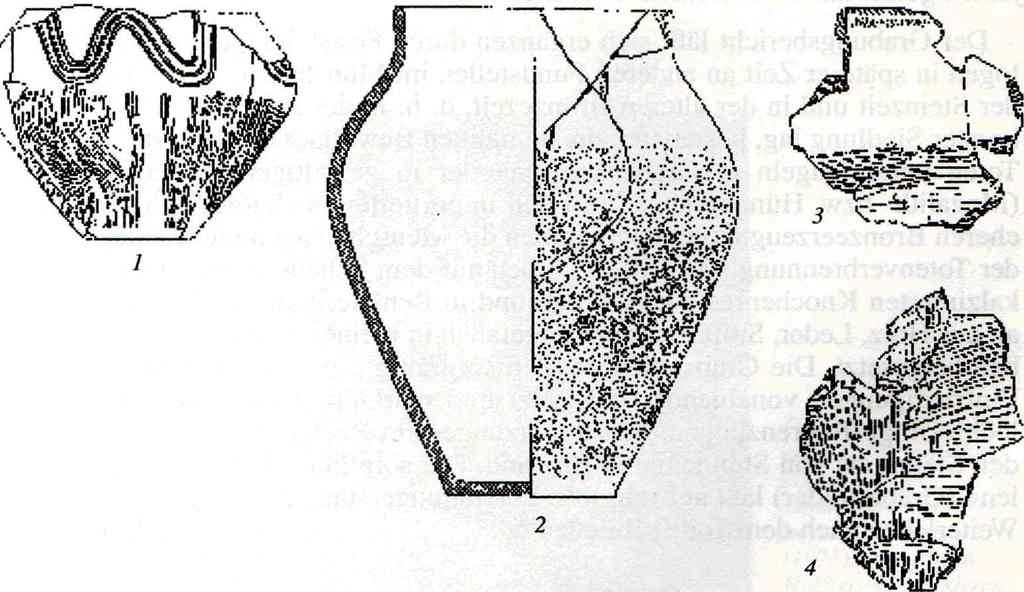 Bild:
Bild:
Die Urnenfunde vom Martiniring: 1 Doppelkonisches Gefäß, Haus 1; 2 = Urne mit S-förmigem Profil, Haus 2; 3 und 4 = Gefäßreste aus Haus 4.
15
Haus I: Rest eines doppelkonischen Gefäßes, teilweise verziert Außenwandung mit gelbbraunem rötlich getönten Überzug versehen.
Haus 2: Urne mit S-förmigem Profil; Reste einer Schüssel mit Schräghals; Bodenteil eines größeren grau- bis gelbbraunen Topfes.
Haus 3: Reste eines größeren, dickwandigen Topfes. Außer feinem, hartem Leichenbrand enthielt das Gefäß drei verschmolzene Stücke eines bronzenen Ringes aus drei zusammengedrehten Drähten.
Haus 4: 7-8- Gefäße zerstört; außerdem Randstück eines Kugeltopfes mit Kammstrichmuster; Randstück eines ähnlichen Gefäßes; zugehörige Wandstücke; Bodenreste von zwei gelbbraunen Gefäßeng.
An anderer Stelle beschreibt Gollub zwei Urnen genauer:
Die Urne verrät starke Beziehungen zum nordostdeutschen Raum (Hannover). Mit ihrer sepiabraunen Farbe und ihrer eigentümlichen körnigen Rauhung des Mittelteils fällt sie eigentlich etwas aus dem
Rahmen des bei uns üblichen Tongeschirrs heraus ... Die senkrechte Kammstrichverzierung [einer weiteren Urne] auf dem Unterteil ist durch nachträglich eingeglättete Streifen unterbrochen.
Eigentümlich wirkt die Kombination mit waagerechten, wellenförmigen Horizontreliefen. Das Gefäß fällt außerdem noch dadurch auf daß es mit einer feinen gelbbraunen Tonschicht überzogen
ist.
Der Grabungsbericht läßt sich ergänzen durch Feststellungen, die die Archäologen in späterer Zeit an anderen Fundstellen im Münsterland gemacht haben. In der Steinzeit und in der älteren Bronzezeit,
d. h. in der Zeit, die vor der Sendenhorster Siedlung lag, bestatteten die damaligen Bewohner des Münsterlandes ihre Toten unter Hügeln in Grabschächten oder in gewaltigen Riesensteingräbern
(Megalith- bzw. Hünengräber). Mit den importierten, technologisch fortschrittlicheren Bronzeerzeugnissen übernahmen die Menschen auch die fremdartige Sitte der Totenverbrennung. Die Toten wurden auf
dem Scheiterhaufen verbrannt, ihre kalzinierten Knochenreste gesammelt und in Behältern aus organischem Material, aus Holz, Leder, Stoff, oder in Tongefäßen in kleinen muldenförmigen Erdgruben
beigesetzt. Die Grabstellen wurden sorgfältig durch Erdaufschüttungen und Einfriedigungen voneinander abgesetzt und markiert. Beliebt waren schlüssellochförmige Begrenzungen. Pfostensetzungen im
Rechteck erinnern deutlich an den Steinkreis von Stonhenge in England. Die sorgfältige Anlage der »Nekropolen« (Gräberfelder) läßt auf religiöse Vorstellungen und auf einen Glauben an ein
Weiterleben nach dem Tode schließen.
16
Germanen und Römer
Wir wissen nicht, wie lange die bronze-eisenzeitlichen Siedlungen »Geist« (Gräberfeld Spithöverstraße) und »Schörmel« (Martiniring) bestanden haben. Bei der flüchtigen Dauer frühgeschichtlicher
Siedlungen mag es sich um wenige Jahrzehnte gehandelt haben.
Vielleicht waren die Wohnplätze aber auch länger besiedelt. Die wenigen Funde erlauben jedenfalls keine zeitliche Festlegung. Auch wenn die Siedlungen 50, 100 oder mehr Jahre bestanden, wenn es — was
sehr wohl denkbar ist — noch weitere eisenzeitliche Siedlungen im Raume Sendenhorst gab. eine Siedlungskontinuität bis zum Jahre Null, bis Christi Geburt, ist nicht wahrscheinlich. Denn im Laufe der
letzten vorchristlichen Jahrhunderte hatten sich die Umweltverhältnisse merklich verschlechtert. Es war unangenehm kühl geworden. Die Sommer waren feucht und regnerisch. Ohne Düngung gaben die
kleinen Äcker innerhalb der öden Wildnis nichts her.
Ganz Nord- und Mitteleuropa spürte die Klimaverschlechterung. Deshalb wandenen in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten viele Volksstämme aus dem unwirtlichen Norden in wärmere südliche Gefilde.
Der Zug der Kimbern und Teutonen um 100 v. Chr. ging in die römische Geschichte ein. Auch das Münsterland wurde von der Abwanderungswelle erfaßt. Ungünstige Siedlungsstandorte mußten aufgegeben
werden. Nur besonders gute Plätze blieben noch eine längere Zeit besiedelt. Solch ein günstiger Standort wurde 1971 in Albersloh an der Landstraße nach Sendenhorst in der Bauerschaft Alst, einen
Kilometer vor der alten Gemeindegrenze zu Sendenhorst, entdeckt. Die Archäologen fanden Grubenhütten, Speichergebäude und fünf Pfostenhäuser mit zwei- und dreischiffig gegliedertem Innenraum. Die
Siedelstelle überragt ihre Umgebung beinahe um zehn Meter und erweist sich damit als absolut hoch- und grundwasserfrei. In der Fachliteratur wird die Fundstelle unter dem Begriff »kaiserzeitlich«
geführt.Sie ge‑
 Bild:
Bild:
Freigelegter Grundriß eines kaiserzeitlichen Hauses an der Landstraße Sendenhorst - Albersloh (1971). Die weißen Holzleisten markieren die Standspuren der Pfosten.
17
die Regierungszeit der römischen Kaiser (Beginn etwa Christi Geburt)11). Einstweilen ist nicht bekannt, ob es im Gemeindegebiet Sendenhorst ähnlich günstige Siedlungsmöglichkeiten gab.
Blieben das Sendenhorster Stadtgebiet und das spätere Kirchspiel mit seinen Bauerschaften siedlungsleer? Fragen, auf die wir bislang keine Antwort wissen.
Zurzeit Christi Geburt war das Münsterland fest in germanischer Hand. Zu dieser Zeit rückt der Raum für einige Jahrzehnte aus der Dämmerung archäologischer Mutmaßungen in das Licht der geschriebenen
Geschichte. Von 27 vor bis 14 n. Chr., gut 40 Jahre lang, kämpfte die Weltmacht Rom gegen die unruhigen germanischen Kleinstämme zwischen Rhein und Elbe, die immer wieder beutelüstern den Frieden der
wohlhabenden gallischen Provinzen links des Rheins störten. In einer planmäßigen Großaktion drangen römische Legionen von Mainz bis Xanten über den Rhein tief in das germanische Gebiet vor. Der
römische Vorstoß führte im Süden des Sendenhorster Gebiets vorbei in Richtung Weser. Die Anwesenheit der Römer im Lande mußte sich auch auswirken auf die Siedlungen, die nicht unmittelbar im
Aufmarschgebiet lagen. Die Römer sprachen ihr Recht. Sie legten Märkte an, führten ihre Verwaltung ein und verlangten von den Germanen Tributzahlungen. Im Jahre 9 n. Chr. organisierte der Cherusker
Arminius einen gemeinsamen Aufstand germanischer Stämme. In der »Schlacht am Teutoburger Wald« vernichteten die germanischen Krieger drei römische Legionen, insgesamt 25.000 Mann. Die Schlacht war
der Anfang vom Ende der römischen Herrschaft diesseits des Rheins 12).
Zu dieser Zeit wohnte der Stamm der Brukterer beiderseits der oberen Ems. Südlich der Ems bis hin zur Lippe, das heißt auch in der Region Sendenhorst, siedelten die »Bructeri minori«, die kleinen
Brukterer. Die Brukterer waren die Hauptbeteiligten im Kampf gegen Statthalter Varus. Deshalb galt ihnen und ihrem Wohngebiet der Vergeltungszug des Germanicus, der sechs Jahre nach der Schlacht bis
zum äußersten Winkel des Bruktererlandes vordrang und alle Siedlungen zwischen Ems und Lippe zerstörte. Die germanischen Erstbewohner unserer Heimat, die Brukterer, werden von den römischen
Schriftstellern noch einige Male genannt. Im Lauf des ersten nachchristlichen Jahrhunderts erweiterten sie ihr Siedlungsgebiet nach Südwesten bis an den Rhein. 68 n. Chr. unterstützten sie die
linksrheinischen Bataver bei einem Aufstand gegen die römische Herrschaft in Gallien. Einige Jahrzehnte später gerieten die Brukterer mit ihren germanischen Nachbarn, den Chamaven und Angrivariern,
aneinander. Sie wurden besiegt, gaben ihre Wohnsitze im heutigen Kreis Warendorf auf und siedelten fortan südlich der Lippe. Am Vorabend der Sachsenkriege Karls des Großen, um 750, hieß das Land
zwischen Lippe, Rhein und Ruhr der Gau »Borachtra«. 16)
Frühes Mittelalter
Völkerwanderung - Frühes Mittelalter - Sächsische Landnahme - Sachsensiedlungen im Sendenhorster Raum - Sachsenkriege - Christianisierung
Völkerwanderung
Die Abwanderung der Brukterer, ihr abrupter Ortswechsel aus unserem Raum über die Lippe und weiter bis an den Niederrhein, ist nur ein Steinchen in dem bunten Mosaik, genannt »Völkerwanderung«. Seit
dem 2. nachchristlichen Jahr-hundert verbreiteten sich verstärkt Unruhe und Aufbruchsstimmung unter den germanischen Kleinstämmen Nordwestdeutschlands. Diese germanischen Bewohner des Münsterlandes,
der Lippe- und Hellwegzone, spielten nach Aufgabe ihrer alten Siedlungsgebiete eine entscheidende Rolle bei der Bildung des Großstammes der Franken und der Gründung des Frankenreiches. Als die
römische Grenzverteidigung um 250 zusammenbrach, überfluteten germanische Krieger- und Abenteurerscharen den Niederrhein. Die Brukterer finden wir eine Zeitlang als heerfolgepflichtige Bundesgenossen
der Römer im Raum Köln. Im 5. Jahrhundert bilden sie den Kern des fränkischen Teilstammes der Ripuarier, der Uferfranken, mit Wohnsitz an Maas, Mittel- und Niederrhein. Die Aktivitäten der Brukterer,
ihre abenteuerlichen Beutezüge in das römische Gallien, müssen einen starken Eindruck bei den daheimgebliebenen Sippen im Münsterland und im übrigen rechtsrheinischen Germanien hinterlassen haben.
Das lockte zur Nachahmung. Das reiche römische Rheingebiet entwickelte so eine starke Sogwirkung, daß sich unser Raum nach und nach entvölkerte. Dorf für Dorf, Gehöft für Gehöft wurde aufgegeben und
von den nach Westen Abziehenden verlassen. Um das Jahr 300, vielleicht auch einige Jahrzehnte später, begannen weite Teile des Münsterlandes, von der heutigen Grenze zu den Niederlanden bis zum
Teutoburger Wald, sich zu entvölkern. Das Kernmünsterland, auch der Sendenhorster Raum, wurden schließlich völlig aufgegeben, wurden unbewohnt und verödeten13.
Nachdem die germanischen Siedlungen in unserem Gebiet - wo immer sie gelegen haben mögen - verlassen waren, entwickelte sich in den folgenden Jahr-hunderten, in einem Zeitraum zwischen 350/400 und
550/650, das Kernmünsterland zu einer menschenleeren, unberührten Urlandschaft zurück. Wie es durch die Bodenbeschaffenheit vorgegeben war, überwucherten nach und nach dichte Wälder das Sendenhorster
Gebiet. In den Tälern von Helmbach und Angel wuchsen Eschen. Der von West nach Ost verlaufende Kiessandrücken von der »Geist« bis zur »Hardt« bewuchs mit Eichen, Buchen und Birken. Im Unterholz
wuchsen Drahtschmiele und Heidelbeeren. Den größten Teil des Gemeindegebiets bedeckte, genau wie in den Nachbargemeinden Ahlen und Vorhelm, ein Kalk-, Eichen- und Hainbuchenwald 14).
Sächsische Landnahme
Während die heimischen Brukterer das Münsterland verließen, um sich mit an-deren Gruppen zum Großstamm der Franken zu vereinigen, schlossen sich im Norden Deutschlands kleine, oft wenige hundert
Familien zählende Stämme zu dem schlagkräftigen Großstamm der Sachsen zusammen. Auch die Sachsen wurden von der Unruhe der Wanderungszeit ergriffen. Ein Teil wagte sich über die Nordsee, segelte zu
den Küsten Englands, raubte und plünderte und wurde schließlich seßhaft (»Angelsachsen«). Auf der Suche nach neuem Siedlungsraum zogen sächsische Sippen aus ihrer Heimat, den weiten Ebenen des
Nordwestfälischen Tieflandes zwischen Weser und Ems15), nach Süden und erreichten das nahezu menschenleere Münsterland. Die Sachsen waren in Heeresgruppen oder »Heerschaften« organisiert, die sich
Westfalen, Engern und Ostfalen nannten 16). Mit einem Herzog an der Spitze, meist selbständig operierend, nahmen die sächsischen Teilstämme Besitz von dem weitgehend entvölkerten westdeutschen
Gebiet. An den meisten Stellen vollzog sich die Besitznahme friedlich, das Gebiet war ja unbewohnt. Wo die Sachsen aber auf einen Gegner stießen, kam es zu blutigen Kämpfen (so um 650 bei Beckum).
692 überschritt die Heeresgruppe der Westfalen die Lippe. Damit kamen sie den Franken in die Quere, die das Gebiet zwischen Ruhr und Lippe als ihr Interessengebiet ansahen. Ein jahrzehntelanger
Kleinkrieg begann zwischen den beiden germanischen Großstämmen den Franken und Sachsen. Der Frankenkönig Karl der Große erzwang schließlich in einem dreißigjährigen Kampf die Entscheidung. Die
Sachsen wurden unterworfen, christianisiert und in das Frankenreich eingegliedert.
Im Verlauf ihrer gewaltsamen Eroberungen und der friedlichen Landnahmen hatte sich bei den Sachsen ein Kriegeradel gebildet, außerordentlich herausgehoben und privilegiert. Das waren die Männer, die
die Rodungen und Ansiedlungen der übrigen Sachsen, der Freien und Halbfreien, anordneten und überwachten. Sie waren die eigentlichen Besitzer von Grund und Boden. Wehe den, der es wagte, einen
Adligen zu töten. Er zahlte sechsmal soviel Bußgeld (Wergeld) wie bei der Tötung eines Freien. Eine Vorstellung von Macht und Ansehen eines sächsischen Adligen vermittelt das 1959 in Beckum
aufgedeckte sächsische »Fürstengrab«. Der Herzog, oder welchen Titel er gehabt haben mag, ein 50jähriger, kräftiger, 1,90 m großer Mann muß im Kampf gefallen sein. Er wurde von seinen Gefolgsleuten
auf seinem Schild begraben. Durch und durch heidnisch sind die zahlreichen kostbaren Grabbeigaben: Trinkbecher aus seegrünem dünnen Glas, goldene Taschenbeschläge, silberne Riemenbeschläge, im Mund
eine Goldmünze des Kaisers Justinus II., Wegegeld für den Fährmann am Totenfluß. Die persönlichen Waffen wurden dem Fürsten ins Grab gelegt: das zweischneidige Schwert mit vergoldetem Knauf, das
eiserne Messer, die eiserne Breitaxt 17).
Um das Jahr 650, so sagen die Archäologen, soll der sächsische Fürst von Beckum gefallen sein. In diesem Zeitraum dürften auch die Landnahme und Besiedlung der Nachbarschaft Beckums, also auch
Sendenhorsts, stattgefunden haben. Spätestens 650 tauchten sächsische Bauernkrieger in dem seit mehr als 200 Jahren verödeten Sendenhorster Raum auf, errichteten Holzhäuser für Mensch und Vieh und
begannen, Ackerland zu roden und zu besäen. Wie eine altsächsische Siedlung aussah, darüber wissen wir recht genau Bescheid. In den Jahren 1951-1959 wurde bei Warendorf am Südufer der Ems eine
Ansiedlung der Sachsen ergraben, die rund 150 Jahre bestanden hatte und von den Franken nach Deportation der Bewohner gegen 790 vernichtet worden war. Die sächsische Siedlung Warendorf besaß rund 150
Häuser und 70 Grubenhütten, meist Webhütten. Die Werkzeuge, das Handwerkzeug und der gefundene Schmuck lassen auf einen gewissen Wohlstand schließen. Die Keramik-Kümpfe, eiförmige Töpfe und
Kugeltöpfe, gehören zu einer einheitlichen Formengruppe, die sowohl in Dänemark als auch in England und im übrigen Norddeutschland verbreitet war. Auch der Grundriß der Wohnhäuser zeigt die
kulturräumliche Einheit Nordwestdeutschlands zu dieser Zeit. Es sind einschiffige Hallen, bis zu 30 m lang, mit außenstehenden Stützen, einem Schiffsrumpf ähnlich.
Sachsensiedlungen im Sendenhorster Raum
Im Schweiße ihres Angesichts, unvorstellbar mühsam, unter unsagbar großer Kraftanstrengung rodeten sächsische Bauern die Sendenhorster Wildnis, besäten ihre kleinen Äcker und bauten Unterkünfte für
Mensch und Vieh. Auch wenn sie persönlich frei waren, wenn sie in der Regel ziemlich selbständig wirtschaften konnten, blieb doch die letzte Verfügungsgewalt über Grund und Boden bei dem adligen
Grundherrn. Das war im christlichen Mittelalter so, das war aber auch schon so in heidnisch-sächsischer Zeit. Die romantische Vorstellung, freie Bauern hätten aus freier Initiative in
uneingeschränkter Eigenverantwortlichkeit gerodet und gesiedelt, ist sympathisch, aber falsch. Von Anfang an überragte der Adel sozial, macht- und besitzmäßig die Masse der Freien, Halbfreien und
Sklaven 19).
Man darf annehmen, daß die Siedlungen des Sendenhorster Raumes, wie sie in den frühmittelalterlichen Aufzeichnungen des Klosters Werden genannt werden, auch schon im 8. Jahrhundert bestanden haben.
Um das Jahr 750, am Vorabend der Unterwerfung des Sachsenlandes durch die Franken, gab es demnach in Sendenhorst hochgerechnet sechs bis acht Siedlungen mit je zwei bis vier Höfen. Die Auswertung
ergibt: Auf dem späteren Stadtgebiet Sendenhorst (ohne Albersloh versteht sich) wohnten ungefähr 150 Menschen auf etwa 20 bis 25 Hofesstellen 20). Wie in Warendorf waren die Sendenhorster Höfe
vollständig autark, unabhängig von der Außenwelt. Sie waren Selbstversorger auf allen Gebieten. Sie webten ihr Leinen und ihre Wollstoffe in den Webhütten, schmiedeten Pflugscharen, Messer und Äxte
in den Schmiedehütten am Rande der Gehöfte und formten und brannten ihr Geschirr für den täglichen Bedarf, die für den sächsischen Kulturraum charakteristischen Kümpfe und Kugeltöpfe.
Die sächsischen Siedler legten ihre Hofesstellen nach Möglichkeit nicht weit von fließenden Gewässern an. Das mitgebrachte Vieh lieferte die erste Nahrungsgrundlage. Es wurde in der nahen Bachaue
geweidet. In Hofesnähe legte jeder Bauer für sich einen blockförmigen Acker an. Der Boden wurde mit dem Haken oder »Arder« aufgelockert und mit dem Streichbrett geglättet. Erst später lernte man den
eisernen Scharpflug benutzen, der im Gegensatz zum Hakenpflug den Boden nicht nur aufreißt, sondern die Erdschollen zur Seite wirft. Am einfachsten ließen sich mit dem Scharpflug schmale, lange
Streifen pflügen. Beim Herauf- und Hinabpflügen wurden die Schollen zur Mitte des Ackers angehäuft. So entstanden trockene Hochbeete, sogenannte Wölbäcker, an deren Rändern das Regen- oder
Grundwasser ablaufen konnte. Die strohgedeckten Häuser der altsächsischen Bauern hatten nur eine begrenzte Lebensdauer. Nach wenigen Jahrzehnten waren die Pfosten durchgefault, ein Neubau wurde
notwendig. Dabei wanderte das Haus weiter, rückte von der alten Hofstelle ab. Weil die Ackerwirtschaft zunahm und die Viehhaltung zurückging, wurde der erste Siedlungsplatz überpflügt. So wanderten
die Gehöfte im Laufe des frühen Mittelalters immer weiter von der Ursiedlung weg, bis sie im Hochmittelalter ihren endgültigen, bis heute beibehaltenen Standort erreichten. Die Anfänge der Siedlungen
Elmenhorst und Schörmel (Rinkhöven) sind sicherlich in unmittelbare Nähe der Angel zu suchen, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Angel ihren Lauf einige Male geändert hat. Die ersten Sendenhorster
Höfe könnten am Rande des Helmbachs gelegen haben. Denkbar ist ebenfalls, daß die Siedlung Sendenhorst ganz ohne einen Bachlauf auskam und das nötige Wasser für Mensch und Vieh aus Brunnen geschöpft
wurde.
Als die sächsischen Bauern den Wendepflug zu gebrauchen lernten, wurde eine Anbautechnik üblich, die bis in die Neuzeit nicht mehr verändert wurde. man pflügte in langen Bahnen. Es entstanden
schmale, oft mehr als hundert Meter lange Ackerstreifen. An den Kopfenden, wo der Pflug gewendet wurde, auf der »Anewende«, mußte genügend Raum sein. Ansonsten legten die Bauern ihre
Langstreifenfluren ohne Weg und Grenzsaum nebeneinander. Die Gemeinschaftsäcker mit den schmalen Äckern in Gemengelage heißen »Esch«. In Sendenhorst ist meist das Wort »Feld« gebräuchlich (Rinker
Feld, Härder Feld, Brüser Feld, Hemmer Feld). Die Esche sind zwar nicht, wie die Ausgrabungen der letzten Jahre ergaben, die ältesten Ackerfluren, aber nur die ältesten Höfe hatten Langstreifenbesitz
auf dem Esch. Und so bearbeiteten zwei bis drei, nach Anstieg der Bevölkerung auch fünf bis sechs Bauern gemeinsam das Feld, an dem jeder Hof mit mehreren langen Streifen im Gemenge mit seinen
Nachbarn beteiligt war. Es bestand Flurzwang. Zu einem festgelegten Zeitpunkt wurde gemeinsam gesät und auch geerntet.
 Bild [red. ergänzt]:
Bild [red. ergänzt]:
Das Sachsenhaus bei Münster-Gittrup (bei Greven als Sachsenhof wiederaufgebaut). Solche schiffsförmigen Häuser mit vorgezogenem Eingang und schräg gestellten Außenpfosten wurden mit dem Vordringen
der Sachsen in ganz Nordwesteuropa verbreitet. Auch die Häuser der Sendenhorster Sachsen werden so ausgesehen haben.
Die vermutliche Siedlungsentwicklung wurde auf Grund von Siedlungsnamen, frühen Besitzverhältnissen, teilweise auch von Flurnamen nachgezeichnet. Im Großen und Ganzen wird sie sich so abgespielt
haben. Eindeutigere Aussagen über die frühmittelalterlichen altsächsischen Siedlungen können jedoch nur Bodenfunde oder Ausgrabungen erbringen. Leider sind bisher außer einigen frühgeschichtlichen
Kugeltopfscherben in der Bauerschaft Elmenhorst keine Funde gemacht worden 21). Vielleicht bringt uns die Zukunft mehr Erfolg und damit genauere Erkenntnisse.
Sachsenkriege und Christianisierung
An der sächsisch-fränkischen Grenze längs des Rheins gab es ständig Ärger. Die Sachsen wollten keine Ruhe geben. Der Adel führte seine Bauern, freie und halbfreie Fußkrieger, mit Messer und
Kurzschwert, dem sogenannten »Sachs«, ausgerüstet, in das fränkische Gebiet zu immer neuen Beutezügen. Karl, der Sachsenkönig, den man später den Großen nennen sollte, organisierte 772 erstmals einen
Feldzug gegen die Sachsen. In seinem Heere marschierten Priester und Mönche, die die Bewohner Sachsens in großangelegten Massenversammlungen zur Taufe führen sollten. Waren die Sachsen erst einmal
Christen, schworen sie Karl den Eid, dann waren sie dem fränkischen Reich eingegliedert, und jeder Ungehorsam, jeder Aufstand, war Hochverrat. Bislang hatten die starrsinnigen Sachsen allen
Bekehrungsversuchen widerstanden. Die Bemühungen angelsächsischer Mönche hatten sie nicht beeindruckt. Nach Vätersitte versammelten sie sich an heiligen Stätten, an Quellen, Bäumen, Hainen und
opferten ihren Göttern Wodan, Donar und Saxnot. Das germanisch-sächsische Glaubensbekenntnis war düster, fatalistisch. Der Mensch war seinem Schicksal hoffnungs- und ausweglos ausgeliefert. Dagegen
konnte die christliche Lehre von der Erlösung des Menschen durch den Sohn Gottes dem Leben wieder einen Sinn geben, konnte Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Aber das Christentum war die Religion
der Feinde, der Franken. Besonders die bäuerlichen Schichten der Freien und Halbfreien wehrten sich verbissen gegen die fränkische Mission, die nicht nur einen neuen Glauben, sondern zunächst einmal
wirtschaftliche Veränderungen bringen sollte, nicht unbedingt zu ihrem Vorteil. Im Sommer waren die Sachsen zu den Massentaufen an Quellen und Flüssen geströmt. Wenn die Franken wieder in ihren
Winterquartieren jenseits des Rheins waren, war das christliche Glaubensbekenntnis vergessen. Die Priester wurden erschlagen, die Missionskirchen niedergebrannt. Unter ihrem Herzog Widukind traten
die Sachsen in den Aufstand. Der dreißigjährige sächsisch-fränkische Krieg begann. Karl beschloß, seine Truppen ständig im Sachsenlande zu halten. Wie vor 800 Jahren die Römer, legten die Franken
Marschlager, Königshöfe, zur Sicherung ihrer Heereswege an. Weil die Sachsen keinen Frieden geben wollten, erließ Karl der Große 782 die berüchtigte »Capitulatio«, die Verordnung für die Sachsen. Mit
außerordentlich harten Bestimmungen zwang er die widerspenstigen Sachsen zur endgültigen Anerkennung der christlich-fränkischen Herrschaft. Die Gesetze trafen die Sachsen vor allem wirtschaftlich.
Sie bedeuteten einen empfindlichen Eingriff in die bisherige Wirtschaftsstruktur. Eine bäuerliche Bevölkerung, die bislang nur für den Eigenbedarf produziert, kaum Überschüsse erwirtschaftet hatte -
wozu auch? -, sollte plötzlich einen beachtlichen Teil der Ernte abliefern. Das bedeutete mehr produzieren oder hungern. Verbissen war der Widerstand der Sachsen. Zwei Bestimmungen trafen besonders
hart: der Kirchenbau und die Zehntpflicht. Jeweils 120 Familien, ein sächsisches Großhundert, mußten zwei Hufen, zwei Bauernhöfe, dazu Knecht und Magd, für den Unterhalt einer Kirche und ihres
Geistlichen stellen. Nach alttestamentarischem Brauch sollte jeder Bauer den zehnten Teil des Rohertrags seiner Felder (Kornzehnt), dazu das zehnte Füllen, Ferkel, Kalb (blutiger Zehnt) abliefern.
Der Zehnte sollte dem Träger der Mission zukommen, das war in unserer Region der Bischof von Münster.
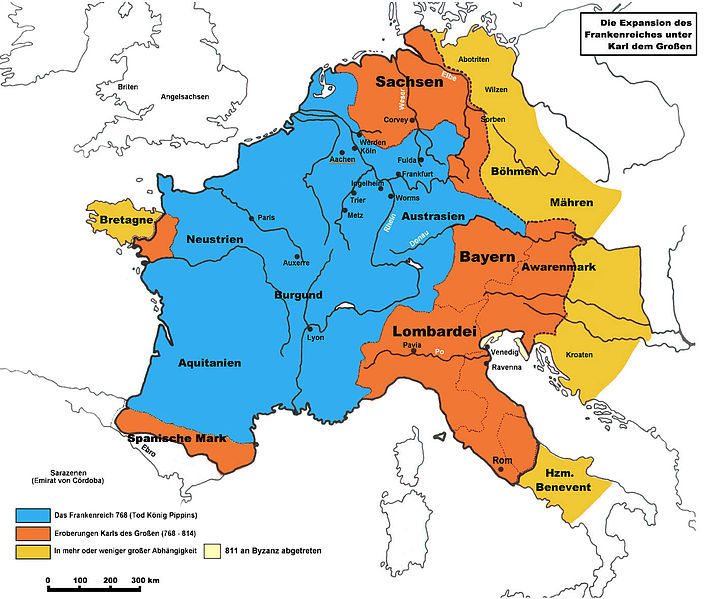 An den Aufständen gegen die fränkischen Herren unter Führung ihres Herzogs Widukind haben sich die Sendenhorster Sachsen mit großer
Wahrscheinlichkeit beteiligt. Mit ihrem Stamm ließen sie sich taufen, wurden Christen und zahlten Zehnt und Kirchensteuern. Für das Jahr 784 melden die fränkischen Königsannalen kriegerische
Auseinandersetzungen im Raum. Die Westfalen wollten sich an der Lippe versammeln, aber das fränkische Heer stellte sich ihnen entgegen und besiegte sie im Dreingau 26). Der Dreingau, das
ist bis in das hohe Mittelalter der Name des Siedlungsraumes »Kernmünsterland« einschließlich Münster und Sendenhorst. Bei diesem Einfall in den Dreingau mag die Siedlung Warendorf zerstört worden
sein; seine Bewohner wurden wahrscheinlich umgesiedelt.
An den Aufständen gegen die fränkischen Herren unter Führung ihres Herzogs Widukind haben sich die Sendenhorster Sachsen mit großer
Wahrscheinlichkeit beteiligt. Mit ihrem Stamm ließen sie sich taufen, wurden Christen und zahlten Zehnt und Kirchensteuern. Für das Jahr 784 melden die fränkischen Königsannalen kriegerische
Auseinandersetzungen im Raum. Die Westfalen wollten sich an der Lippe versammeln, aber das fränkische Heer stellte sich ihnen entgegen und besiegte sie im Dreingau 26). Der Dreingau, das
ist bis in das hohe Mittelalter der Name des Siedlungsraumes »Kernmünsterland« einschließlich Münster und Sendenhorst. Bei diesem Einfall in den Dreingau mag die Siedlung Warendorf zerstört worden
sein; seine Bewohner wurden wahrscheinlich umgesiedelt.
Von der bäuerlichen Siedlung zum Kirchdorf
Sendenhorst
Wie die Geschichte nach den Sachsenkriegen weiter verlief, wie und vor allem wann sich eine selbständige Pfarre Sendenhorst entwickelte, warum ausgerechnet Sendenhorst, eine Siedlung wie jede andere,
namengebend für die neue kirchliche Verwaltungseinheit wurde, das alles wissen wir vorläufig nicht. Wenn wir auch nicht den Zeitpunkt kennen, so läßt sich der mutmaßliche Ablauf der Pfarrgründung
nachvollziehen. Dazu müssen wir die Entstehung der bäuerlichen Siedlung Sendenhorst nachzeichnen. Hier war die Urzelle des späteren Pfarrhofs und des mittelalterlichen bischöflichen Hauses
Sendenhorst.
Die altsächsische Siedlung Sendenhorst läßt sich durch sorgfältige Sichtung der Flurnamen, der Besitzverteilung und der Grundherrschaften erschließen. Der heutige Straßenname »Auf der Geist« erinnert
an die älteste Ackerflur, ist aber genaugenommen unzutreffend, denn die am Kapellchen von der Landstraße Münster-Beckum nach Norden abzweigende Wohnstraße liegt nicht auf, sondern an der Geist. »Zur
Geist«, genauso wie der Hofesname Tergeist, träfe die geographischen Verhältnisse besser. Westlich dieses alten Flurweges liegt auf deutlich gewölbtem, von West nach Ost verlaufendem Kiesrücken das
»Sendenhorster Esch oder die Geist«, so auf einer Karte von 1731 31). Der Flurname »Geist« ist im Münsterland häufig. Er kommt auch in anderen Sendenhorster Bauerschaften vor und meint
halb sandigen, halb lehmigen Boden in grundwassergeschützter Höhenlage. Wie bei vielen Geistfluren handelt es sich auch bei der Sendenhorster Geist um von Nord nach Süd verlaufende Langstreifenfluren
in Gemengelage. Nach jahrhundertelanger ständiger Nutzung gab der Boden auf der Geist nicht mehr viel her. Geist-Grundstücke hatten keinen sehr hohen Handelswert. Sie wurden selten verkauft und nur
gelegentlich getauscht. Deshalb ist es möglich, aus dem Register der Pastoratsländereien von 1583, der Flurkarte von 1731 und dem hundert Jahre jüngeren Urkataster die ältesten Eigentümer der
Grundstücke auf der Geist und damit gleichzeitig die ältesten Höfe zu erschließen. Die Hofesstellen lagen am südlichen Rande des Gemeinschaftsackers, an der Wasseraustrittsstelle. Die
hochmittelalterliche Straße von Münster nach Albersloh nach Beckum führt zwischen Höfen und dem Esch hindurch. Sechs Höfe, die wiederum durch Teilung aus drei Urhöfen hervorgegangen sind, lassen sich
als Keimzelle der Siedlung Sendenhorst ausmachen.
Siedlung Sendenhorst - Älteste Höfe
|
800
|
Name
|
Besitzer vor 1200
|
Besitzer um 1500
|
|
Hof 1
|
Rüschey
Gobelenhove
|
Graf von Arnsberg
?
|
Kloster Liesborn
Fraterherren
|
|
Hof 2
|
Tergeist
Geisterholt
|
Bischof von Münster
Edelherren von Steinfurt
|
von dem Berge (Lehen)
Rodde
|
|
Hof 3
|
Pastoratshof
Haus Sendenhorst
|
Bischof von Münster
Bischof von Münster
|
Pastor
von Merveldt
|
Als sich der Bischof von Münster entschloß, in Sendenhorst eine Pfarrkirche zu begründen, übereignete er
der neuen Kirche sein Sendenhorster Gut (Hof Nr. 3). Das Kirchgebäude wurde jedoch nicht innerhalb oder bei der Eschsiedlung Sendenhorst, sondern 400 m östlich errichtet. Die Wahl des Ortes verrät
Umsicht und Überlegung. Der Platz liegt zentral für die übrigen zugeordneten Siedlungen. Er ist der höchste Punkt auf dem nach Osten fortlaufenden Kiesrücken. Noch heute kann man erkennen, daß alle
Straßen zum Kirchplatz hin deutlich ansteigen.
Nachdem das Kirchengebäude abseits der alten Siedlung errichtet worden war, wanderte auch der bischöfliche Haupthof, der Pfarrer und Pfarrei versorgen sollte, vom Esch weg in das neue Zentrum. Später
wurde dieser Hof geteilt. Was nicht dem Pastorat verblieb, wurde bischöfliches Lehnsgut, aus dem sich dann das feste Haus Sendenhorst im Süden des Stadtgebiets, der »Drostenhof« entwickelte. So
könnte sich die Entstehung und Entwicklung Sendenhorst von der altsächsischen Siedlung bis zur bischöflichen Pfarrei vollzogen haben. Urkundliche Anhaltspunkte gibt es nicht. Das ist nicht
ungewöhnlich, denn die meisten sehr alten Orte oder Pfarreien werden erst im 11. oder 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt. So ist auch die erste Nennung der Pfarre Sendenhorst keineswegs
gleichzusetzten mit dem Gründungstermin.
Dorf und Kirchdorf Sendenhorst - Erste urkundliche Erwähnungen
1175. Westfälisches Urkundenbuch II, Urkunde 376.
Graf Heinrich von Arnsberg gestattet seinem Dienstmann Gottfried von Perreclo (Brexel, Wadersloh), einen Hof beim Dorf Sendenhorst aus Anlaß des Klostereintritts seines Sohnes Liesborn zu übertragen.
(Es handelt sich um den Liesborner Hof Rüschey, dessen alte Hofesstelle in der späteren Bauerschaft Brock, ursprünglich Kössendrup, beim Hof Niestert gelegen hat).
Ende 12. Jahrhundert. Evangeliar des Klosters Überwasser.
Randbemerkungen über den frühen Besitzstand des Klosters: Drei Brüder von Saltesberge hatten mehrere Dienstleute in der »parrochia Sendenhorst« (Pfarrei Sendenhorst), denen sie die Freiheit schenkten
und die sich darauf dem Stift Überwasser als Ministeriale übergaben. Ihre Namen waren Margareta mit ihren Kindern Herimann, Wernher, Dietrich, Heinrich, Bruno; dazu Alveradis, Schwester der
Margareta, mit ihren Kindern Bruno, Menburgis, Margareta, und Johannes 32).
1230. Westfälisches Urkundenbuch III, Urkunde 271.
Bischof Ludolf von Münster bekundet den Erwerb eines Zehnten des Klosters Hohenholte von Konrad von Lüdinghausen (decimam in parrochia Sendenhorst = Zehnt in der Pfarrei Sendenhorst). Der Zehnt
brachte jährlich 11 Schilling und 12 Maß Weizen ein) 33).
⇱ ⇖ ↑
Reise zu den Anfängen: Die ältesten Orts- und Flurnamen
 Bild [redaktionell ergänzt]:
Bild [redaktionell ergänzt]:
Der Landwehrwall und -graben im Jahr 2014 - Bauerschaft Bracht - Steht unter Denkmalschutz.
Wir wissen heute nicht mehr, wie der Raum Sendenhorst von den ersten bronze- oder eisenzeitlichen Siedlern
rund 500 Jahre vor Christi Geburt genannt wurden, welchen Namen die beiden bisher bekannten Siedlungen hatten. Auch aus brukterischer Zeit, 500-600 Jahre später, ist kein Orts- oder Siedelname
überliefert. Mit den abziehenden Stämmen verschwanden die Siedlungen und mit ihnen die Orts- und Siedlungsnamen. Dauerhafter hielten sich häufig Fluß- und Bachnamen. Auch bei Aufgabe von Siedlungen
hafteten Gewässernamen im Gedächtnis von Nachbarn oder durchziehenden Stämmen. So hat sich im Osten des späteren Sendenhorster Gemeindegebiets ein Name erhalten, der nach Meinung der Sprachforschung
in die vorgermanische Zeit zurückreichen soll: Das Werdener Güterverzeichnis um 880 nennt eine Hofesgruppe »Gesandron« (Geilern). Es handelt sich um eine sehr altertümliche Namensform. Schon der
griechische Dichter Homer, der den Kampf um Troja und die Irrfahrten des Odysseus besang, nennt den kleinasiatischen Fluß »Maiandros«. Offensichtlich ist auch Gesandros, Gesandron ursprünglich ein
Flußname gewesen, möglicherweise der alte Name der Angel.
Es ist unwahrscheinlich, daß alle durch die späteren Bauerschaftsnamen dokumentierten alten Siedlungen in die erste Zeit der sächsischen Landnahme zurückreichen. Der Landausbau erstreckte sich über
mehrere Jahrhunderte, kam erst im hohen Mittelalter zu einem vorläufigen Abschluß. Von Norden oder Nordwesten kommend, besiedelten die sächsischen Bauern zunächst den Kiessandrücken und begründeten
die Siedlungen Sendenhorst, Schörmel und Hardt. Ein oder zwei Generationen später, vielleicht sogar 100 bis 300 Jahre später, drangen sie weiter nach Norden und Süden vor und legten weitere
Siedlungen an: Bracht, Elmenhorst, Jönsthövel, Sandfort. Die Namen der ersten Siedlungen, die sich vielfach im hohen Mittelalter zu Bauerschaften entwickelten, sind in den ältesten
Einnahmeverzeichnissen der Klöster, in der »Werdener Urbare« von 880 bis 900 und in der Freckenhorster Heberolle von 1050 verzeichnet. Auffällig ist die starke Verwendung von Namen, die mit »Wald« in
Verbindung stehen. Der Sendenhorster Raum muß also zu Beginn der Besiedlung dicht bewaldet gewesen sein.
Am südlichen Rand des Kiessandrückens legten die Sachsen eine Hofesgruppe an, die sie »Seondonhurst« nannten, so lautet jedenfalls die erste schriftliche Erwähnung um 900. Der Name zerfällt in ein
Grundwort »Horst« und ein Bestimmungswort »Seondon« (Sinden, Senden, Zinden, Zenden). Das Grundwort »Horst« läßt sich ohne Schwierigkeiten deuten. Es kommt im Münsterland in vielen Orts-,
Bauerschafts- oder Hofesnamen vor. Bis heute heißt ein Waldgebiet im Westen Hoetmars »Ketteler Horst« (nach der Familie von Ketteler, den ehemaligen Besitzern des Hauses Hoetmar). Ein »Horst« ist ein
Gestrüppwald oder einfach ein »Wald«, oft in Höhenlage, jedenfalls kein undurchdringlicher Urwald, sondern ein lichter Laubwald, den Jäger durchreiten können. Nach anderer Lesart ist der Horst eine
Stelle, wo ein Wald gestanden hat 23). Das
Bestimmungswort »Senden« entzieht sich leider jeder einleuchtenden Erklärung, und wir tun gut daran, auf alle bisher angebotenen Deutungsversuche zu verzichten. Auf dem östlichen Ausläufer des
Kiesrückens lag die Siedlung »Hardt« (1100 Harth), benannt nach einem Wald. Hart war ein weitverbreitetes Wort für Waldungen (vgl. Spessart = Spechtshart, Spechtswald). Der Name der kleinen
Hofesgruppe »Bracht« (880 Braht) im Süden, auf dem Wege nach Ahlen, ist ebenfalls von einem alten Wort für Wald abgeleitet. »Elmenhorst« (880 Elmhurst), im Norden des heutigen Gemeindegebiets,
enthält neben dem Grundwort »Horst« das Bestimmungswort Elm, auch Helm. Die Bezeichnung ist als Flur- und Gewässername in unserer Gegend nicht selten, sie steckt möglicherweise auch in dem Ortsnamen
»Vorhelm«. Nach A. Schulte ist auf keinen Fall an »Ulme« zu denken, sondern an plattdeutsch »Eilm, Äilm« (Produkt eines Verwitterungsvorgangs auf Kleigrund, vor allem auf kalkigem Boden). Elmenhorst
bedeutet also Wald auf verwittertem Kalkboden 25).
Der Siedelname »Sandfort« (1100 Scandfort, richtiger wohl Seandfort) besteht aus den Wortteilen Sand und Furt = Durchgang, Weg. Über Sandfort lief ein frühmittelalterlicher Fernweg.
Im südlichen Gemeindegebiet, zur Ahlener Grenze hin, steigt das Gelände sanft und stetig bis auf ungefähr 100 m u. M. an. Eine Erhebung, ein Hügel heißt im Altsächsischen »huvil«, »huvila«. Zwei
Hügel-Siedlungen sind bekannt. Wo heute der Ahlener Damm die alte Landwehr durchquert, bei den Kogge-Höfen, nennen die Werdener Urbare die Siedlung »Ramshövel« (880 Hramashuvila) = mit Lauch
(Bärenklau) bewachsener Hügel (vgl. altengl. hramesa = wilder Knoblauch). Der Zufall wollte es, daß Ramshövel in den spätmittelalterlichen Steuerlisten nicht als Bauerschaft ausgewiesen wurde.
Dadurch geriet der Name in den Hintergrund, wurde durch den Namen der Nachbarbauerschaft Bracht verdrängt und ist heute völlig vergessen. Erhalten hat sich dagegen der Name der Siedlung »Jönsthövel«.
In Judinashuvila, am Hügel »Judina«, hatte Freckenhorst um 1100 abgabepflichtigen Besitz. Das Bestimmungswort entzieht sich leider einer Deutung. Natürliche Pflanzendecke. In der Mitte der von West
nach Ost verlaufende Uppenberger Kiessandrücken (nach Otto Lukas, Planungsgrundlagen für den Landkreis Beckum 1955).
Aus den mittelalterlichen Einnahmeverzeichnissen lassen sich noch weitere eigenständige Siedlungen erschließen, die später nicht mehr vorkommen oder deren Name auf die Bezeichnung eines einzelnen
Hofes beschränkt wurde. Das Sendenhorster Gebiet kennt drei -dorp-Namen. Diese Namensform soll in die Zeit der sächsischen Landnahme zurückgehen. Es soll sich um Einzelhöfe an alten Fernwegen
handeln. Im ältesten Besitzverzeichnis von Überwasser finden wir den Hof »Kulsincthorpe«. Kolsendorp, Kössendrup war im Spätmittelalter eine Bauerschaft, dann ein Hofesname am Rande der Bauerschaft
Brock. Die Hove »Schenctorpe« kommt noch im 15. Jahrhundert vor. Sie war ursprünglich ein selbständiger Siedlungskern zwischen Schörmel und Rinkhöven. Mit der Aufteilung der Schenctorper Ländereien
auf Höfe in der Bauerschaft Rinchoven verschwand auch der Name. Ohne Zweifel war auch »Horstrup« (Horstorpe) ursprünglich ein eigenständiger Siedlungsname. Im Bestimmungswort steckt der »Horst«, der
in Sendenhorst als Grundwort vorkommt. Sollte es sich um denselben Wald handeln? Die beiden Höfe der alten Siedlung, Schulte-Horstrup und Lütke-Horstrup, begegnen ab 1300 bzw. 1363. Das Schulzengut
war Dienstmannslehen der Abtei Freckenhorst, das andere Gut kam an den Dreifaltigkeitsaltar an St. Ludgeri, Münster, war aber um 1770 auf einen Kamp zusammengeschrumpft. Die Bezeichnung des heutigen
Industriegebiets »Schörmel« findet sich als »Scurilingis miri« (Schierlingssumpf) bereits in den Werdener Urbaren des 9. Jahrhunderts. Bis zum Ausgang des Mittelalters wurde »Schorlemer« als eigene
Bauerschaft geführt, bis sie der Siedlung Rinkhöven zugeordnet wurde.
»Rinkhöven« war zunächst nur ein einzelner Hof, die Rinchove (1150). Erst später dehnte sich der Name auch auf die Höfe von Schörmel und Schenctorp aus. Der südliche Teil der Bauerschaft Bracht, zum
Teil auf Sendenhorster, zum Teil auf Ahlener Gebiet, hieß bis in das 16. Jahrhundert »Hemme«. Sowohl das bischöfliche Lehngut »Wisch« als auch das Lehen »Stromberghove«, wahrscheinlich auch das Haus
Hove in der Bauerschaft Borbein, lagen in der Bauerschaft Hemme. Erhalten hat sich die Flurbezeichnung »Hemmer Holt«. Zum Schluß noch ein Blick auf die Siedlung »Brock«, die nicht in die Gruppe der
frühen sächsischen Höfe gehört. Das Brock war nach der Namensdeutung eine tiefliegende, von Brachwasser oder Lachen bildendem Wasser durchzogenen Fläche, ein Bruch. Das Brock war morastig und
sumpfig. Eine Besiedlung erfolgte deshalb erst im hohen Mittelalter.
Die ältesten Pfarreien des Münsterlandes
Bild: Karl der Große verleiht Liudger das brabantische Kloster Lothusa. Buchmalerei aus der Vita secunda
Ludgeri, Berliner Nationalbibliothek ms. theol. lat fol. 233, fol. 8v. - Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist.
-
Mit der Leitung der Mission im sächsischen Stever- und Dreingau, dem Kernmünsterland, beauftragte König Karl den Friesen Liudger. Nachdem endlich Frieden eingekehrt war, verstand es Liudger, erster
Bischof in seinem Missionsbezirk, die Sachsen mit dem Glauben ihrer früheren Feinde zu versöhnen und ihre Herzen für die neue Lehre zu gewinnen. Von 793 bis zu seinem Tode am 29. März 809 arbeitete
Liudger mit ganzer Kraft an dieser Aufgabe. Im Herzen seines Missionsbezirk, am rechten Ufer der Aa, wählte Liudger die Siedlung Mimigernaford, die man später Münster nennen sollte, zum Bischofssitz,
zur gemeinschaftlichen Wohnung der Domkleriker und zum Ausbildungszentrum für den Priesternachwuchs. Noch vor dem Jahr 800 gründete Liudger einen Kranz selbständiger Pfarrkirchen, alle eine
Tagesreise von seinem Bischofssitz entfernt: Ahlen, Werne, Dülmen und Billerbeck. Diese »Urpfarreien« hatten ein riesiges Gebiet, oft von der Größe der heutigen Kreise, zu betreuen. Die Arbeit war
nicht zu leisten, und deshalb wurde das Netz engmaschiger geknüpft. Bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts entstanden weitere Pfarrkirchen.
Die landesgeschichtliche Forschung, insbesondere die Untersuchungen des münsterschen Domkapitulars Adolf Tibus und des ersten Lehrstuhlinhabers für Westfälische Landesgeschichte an der Universität
Münster, Professor Albert K. Hömberg, haben viele scharfsinnige Beobachtungen darauf verwandt, eine lückenlose Stammgeschichte der heimischen Pfarreien zu entwerfen27. Schlüssig wiesen sie die zweite
Generation der Pfarrgründungen rund um Münster nach, die Kirchen zu Greven, Telgte, Ascheberg, Lüdinghausen, Nottuln, Altenberge und Albersloh. Neuerdings sind Zweifel entstanden, ob die Entstehung
von Pfarrbezirken so systematisch, so geradlinig, durch ständige Abpfarrungen und Verkleinerungen verlaufen ist. Mit Sicherheit gehört Albersloh nicht zu den ersten Pfarreien des Bistums, das steht
seit 1965 fest. 1962-1964 ließ die Pfarrgemeinde Albersloh ihre Ludgeruskirche durch einen Anbau nach Osten hin erweitern. Im folgenden Jahr hatte das Landesamt für Denkmalpflege Gelegenheit, eine
gründliche Flächengrabung im südlichen Seitenschiff und weitere Grabungen an verschiedenen Stellen der mittelalterlichen Kirche durchzuführen. Die Grabung erbrachte zwar bedeutende Funde (Münzen,
Bronzeleuchter, Glasscherben, Grabanlagen), aber auch eine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Alter der Pfarrei Albersloh. An der Stelle der heutigen Pfarrkirche Albersloh hat vor dem 11.
Jahrhundert kein kirchliches Gebäude, weder aus Stein noch aus Holz, gestanden. Es hat also keine Großpfarrei Albersloh gegeben, zuständig für Drensteinfurt, Rinkerode, Amelsbüren, Venne, Wolbeck,
Alverskirchen und Sendenhorst.
Es steht fest, die fränkischen Missionare haben Taufkirchen gegründet. Sicherlich hat Bischof Liudger die Grundlagen für weitere Kirchen gelegt. Ob aber damit ein geschlossenes, flächendeckendes
Pfarrnetz ins Leben gerufen wurde, wird neuerdings mit einleuchtenden Gründen angezweifelt. Die Siedlungen des frühen Mittelalters lagen wie Inseln zwischen Wald und Ödland. Feste Abgrenzungen,
Pfarrbezirke waren nicht möglich noch nötig. Erst als die Inseln sich durch Siedlungsausbau zu geschlossenen Siedlungsflächen verdichteten, waren der Zwang zu klaren Grenzen und die Notwendigkeit
weiterer Kirchen gegeben 29). Solange Sendenhorst
keine eigene Kirche hatte, mußten sich die Bewohner dieses Raumes nach einem Nachbarort, wahrscheinlich nach Ahlen, orientieren. Über die dunklen Jahrhunderte zwischen 800 und 1000 wissen wir kaum
etwas. Auch die folgenden beiden Jahrhunderte sind schlecht dokumentiert. Neben der offiziellen christlichen Lehre hielten sich unglaublich lange heidnische Vorstellungen und Bräuche. Das Christentum
war lange Zeit weit davon entfernt, das Leben der bäuerlichen Welt zu prägen. Das änderte sich sehr langsam, im Laufe von Jahrhunderten. Erst im 13. Jahrhundert kann man von einer zunehmenden
Verchristlichung des Alltagslebens sprechen. Seit dieser Zeit bestand in der Bevölkerung ein wachsendes Bedürfnis nach geistlicher Betreuung, nach dem Empfang der Sakramente, nach Messe, Taufe,
Segnung der Brautleute, Belehrung durch die Predigt.
Das Bedürfnis nach sonntäglicher Versammlung zum Gottesdienst an einem festen Kirchenort konnte auf zweierlei Weise erfüllt werden. An zentraler Stelle, dort, wo der Bischof einen Hof zur Ausstattung
der Pfarrei beisteuern konnte, wurde eine neue Kirche begründet. Der häufiger eingeschlagene Weg war, einer bestehenden privaten Kapelle, eine Eigenkirche, die ein Grundherr nur für sich und seine
Hörigen gebaut hatte, die Zuständigkeit für die gesamte Nachbarschaft, für alle Gläubigen in einem bestimmten Umkreis zu übertragen. Die Eigenkirche wurde in den Rang einer Pfarrkirche erhoben. Bei
aufmerksamer Betrachtung lassen sich bischöfliche und eigenkirchliche Gründungen unschwer auseinanderhalten. Eigenkirchen haben geringe Pfarreinkünfte, einen kleineren Kirchbau, sind auf dem Hof
weltlicher oder geistlicher Herren errichtet, die sich das Recht der Einsetzung des Pfarrers vorbehielten. So sicher wie die Pfarreien Alverskirchen, Hoetmar, Enniger, Vorhelm, Drensteinfurt und auch
wohl Albersloh aus Eigenkirchen entstanden sind, so unzweifelhaft ist Sendenhorst eine bischöfliche Gründung. Dafür sprechen die stattlichen Ausmaße der romanischen Kirche des 13. Jahrhunderts, die
überdurchschnittlich gute Ausstattung der Pfarrstelle, die planvolle Anlage auf einem zentralen Punkt, schließlich das bischöfliche Patronatsrecht. Folgende Punkte, am Rande angemerkt und als Indiz,
nicht aber als Beweis ausreichend, sprechen für ein sehr hohes Alter der Pfarrkirche Sendenhorst: Die Sendenhorster Kirche ist dem hl. Martin geweiht, einem Lieblingsheiligen der fränkischen
Eroberer. Martinskirchen haben meist ein hohes Alter. Als Sitz einer Freigrafschaft war Sendenhorst schon früh Verwaltungsmittelpunkt. Allerdings ist die Bezeichnung »Freigrafschaft Sendenhorst« erst
im ausgehenden Mittelalter überliefert. Das Pfarrgebiet griff noch im 14. Jahrhundert auf die Nachbargemeinden aus, die Grenzen waren noch nicht parzellenscharf festgelegt. Zur Pfarre Sendenhorst
gehörten im 13./14. Jahrhundert Wessenhorst (heute Enniger), Grevinghoff (heute Albersloh), Heringloh (heute Altahlen). Die Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte zeigen, daß selbst unbedeutende
Eigenkirchen bis in die Zeit um 1000 zurückgehen. Berücksichtigen wir die Dichte der Besiedlung um die Jahrtausendwende, die Größe und Ausstattung der Pfarrkirche, so können wir die Pfarrei
Sendenhorst auf jeden Fall bis zum Jahr 1000 zurückdatieren. Weitergehende Aussagen sollte man sich solange versagen, bis Bodenfunde gesicherte Erkenntnisse ermöglichen.
Bis zur Gründung einer eigenen Pfarrei müssen sich die Sendenhorster nach Ahlen orientiert haben. Eine Verbindung nach Albersloh bestand weder siedlungs- noch wegemäßig. Zwischen die Bauerschaften
West (Albersloh) und Elmenhorst (Sendenhorst) schob sich ein breiter Heidegürtel (Hinweis Flurname Grevingheide), nach Süden gefolgt von dem Waldgebiet Alst, daran anschließend von dem sumpfig -
morastigen Brock. Die frühmittelalterliche Wegeverbindung von Sendenhorst nach Münster verlief bezeichnenderweise nicht über Albersloh. Die Fernstraße von Münster über Sendenhorst nach Soest zu den
Salzstätten führte vielmehr über Wolbeck, überquerte bei dem bischöflichen Lehngut Brückhausen die Angel und lief westlich am Kirchort Sendenhorst vorbei durch die Bauerschaft Bracht und Hemme nach
Süden 30). Westlich des Kirchdorfs Sendenhorst, dort
wo der Hellweg einen kleinen Bach überquerte, war eine Brücke, die »Hellenbrügge«. (Aus der Bezeichnung »Hellenbrüggenbach« entstand der heutige Gewässername Helmbach.) Die zweite Verbindung von
Münster nach Sendenhorst, über Albersloh führend, entstand erst lange nach Einrichtung des Pfarrsystems. Sie mußte auf die schon bestehenden Kulturflächen Rücksicht nehmen. Deshalb verläuft die
heutige Landstraße Albersloh-Sendenhorst im weiten Bogen um die Ackerfläche »Geist«, der alten Eschflur, herum. Die Frage nach der Urkirche für unseren Raum kann eindeutig nicht beantwortet werden.
Fassen wir zusammen: Für Sendenhorst und die übrigen gleichwertigen Siedlungen (Bauerschaften) des heutigen Gemeindegebiets können wir eine Orientierung nach Ahlen annehmen. Die Kirche St.
Bartholomäus in Ahlen gilt als südöstlicher Pfeiler im Pfarrsystem des hl. Liudger. Beziehungen von Sendenhorst nach Ahlen waren zu jeder Zeit vorhanden, und bis in die Neuzeit stand der Süden
Sendenhorsts, die Bauerschaft Jönsthövel, in engerer Beziehung zu Ahlen.
Grundherrschaft und Siedlungsausbau 900-1100
»Seondonhurst, Gesandron, Elmhurst« - aus den Werdener Urbaren -
Um das Jahr 880 veranlaßte der Abt des Klosters Werden an der unteren Ruhr, der Familienstiftung Bischof Liudgers die Aufzeichnung sämtlicher Besitzungen und Einkünfte. Nachforschungen und Notizen an
Ort und Stelle waren notwendig, die dann im Kloster auf Pergamentblättern säuberlich festgehalten wurden >34)>. eine schreibkundige Kommission machte sich also auf den weiten Weg in den
münsterländischen Dreingau, in das Kernmünsterland. Und so beginnen die Aufzeichnungen für unseren Raum: »In pago Dregini villa Ulidi…« (Im Dreingau, in der Siedlung Oelde …). So wie die einzelnen
Siedlungen und Höfe aufgesucht worden waren, in derselben Reihenfolge wurden sie aufgeschrieben. Ohne Schwierigkeiten läßt sich der Reiseweg der Mönche nachvollziehen. Von Oelde, dem Anfangspunkt der
Inspektionsreise, wandte sich die Kommission nach Südwesten. Über Beckum, Ahlen, Dolberg und Heessen - in diesen Siedlungen hatte die Abtei besonders viele Abgabepflichtige - erreichten die Mönche
schließlich ihren abgabepflichtigen Hof in der späteren Heessener Bauerschaft Dasbeck (Thasbeki).
Nachdem Bauer Lethoc seine Verpflichtungen angegeben hatte, wandten sich die Mönche nach Nordosten, um die Besitzungen im heutigen Gemeindegebiet Sendenhorst aufzuschreiben. Irgendwo zwischen Bracht
und Jönsthövel erreichten die Mönche den Sendenhorster Raum. Eine Gemeinde mit irgendwelchen Verwaltungsbefugnissen gab es zu dieser Zeit noch nicht, nicht einmal eine Pfarrei Sendenhorst. Deshalb
zeichneten die Mönche die Namen der Siedlungen auf, gleichwertig und unterschiedslos nebeneinander, dazu die Vornamen der Pflichtigen und das, was sie abgeben sollten. Aus den Siedlungsnamen haben
sich später oft Bauerschaftsbezeichnungen entwickelt. Sehen wir uns an, was die Werdener Urbare, die Abgaberegister, für Sendenhorst auflisten. Die Bauern werden nur mit ihrem altertümlichen
sächsischen Vornamen genannt. Es wird nach Getreide, in der Regel Hafer oder Gerste, abgerechnet.
In »Gesandron« (Geilern) zahlte Focco 60 Scheffel Gerste und drei Scheffel Mehl. Mit 8 Pfennig, dem Heerschilling, kaufte sich Focco vom Wehrdienst frei, verlor dafür aber die Rechte eines freien
Mannes. In der Nachbarschaft von Geilern verzeichneten die Mönche in der Siedlung »Hramashuvila« (Ramshövel; später Große und Lütke Kogge sowie Heinmann) die pflichtigen Bauern Hrodbracht und
Eburger. Beide lieferten je 20 Scheffel Hafer und Gerste und ein Schwein. In »Braht« (Bracht) wohnte Arnold. Er lieferte 40 Scheffel Hafer und 8 Scheffel Gerste. Darauf ging es noch einmal nach
Ramshövel zurück zum Hause des Eppo, der 3 Scheffel Mehl, 16 Pfennig und 8 Pfennig als Heerschilling zu leisten hatte. In Elmenhorst wohnten einige Leute, die statt Naturalabgaben einen geringen
Geldbetrag zu zahlen hatten. Vielleicht waren es Knechte oder Handwerker, die für den Oberhof Elmenhorst arbeiteten. Vielleicht hatte das Kloster sie als »Wachszinsige« unter seinen besonderen Schutz
gestellt. In »Elmhurst«, so vermerken die Register, zahlte Meinbern zwei Schilling (soweit er in der Lage war), Fastburn ebenfalls, Huno 6 Pfennig. Über Alverskirchen, Telgte, Greven und Münster
erreichte die Kommission schließlich die Albersloher Bauerschaften Berl und Arenhorst. Daß man nicht von Sendenhorst direkt nach Albersloh ging, mag als weiterer Hinweis dafür gesehen werden, daß
zwischen Sendenhorst und Albersloh noch keine Wegeverbindung bestand. Rund 20 Jahre später, um das Jahr 900, ließ Werden ein weiteres Besitzverzeichnis anlegen. Dieses Mal war der Haupthof Werne an
der Lippe Ausgangs- und Endpunkt der Bereisung. Die Aufzeichnungen halten sich nicht an die genaue Reihenfolge der Wegeroute. Die Namen der Besitzer haben gewechselt, die Abgabehöhe hat sich
verändert. Neue Siedlungsnamen sind hinzugekommen. Das zweite Verzeichnis bringt die erste schriftliche Erwähnung des Ortes Sendenhorst: In »Seondonhurst« lieferte Blacheri 30 Scheffel Hafer, dazu
Heerschilling und Heermalter. Zweifellos ist dieser Hof unter den Urhöfen der Eschsiedlung Sendenhorst (auf der Geist) zu suchen. Eine genauere Lokalisierung ist nicht möglich. In »Gesandron«
(Geilern) hatte das Kloster auch dieses Mal abhängige Höfe. Aber Name und Abgabehöhe haben gewechselt: Wirinbold gab 10 Scheffel Gerste, Heerschilling und Heermalter. Ebenfalls aus Gesandron gibt
Bauer Elfing 20 Scheffel Hafer, Heerschilling und Heermalter, dazu ein Tuch von 9 Ellen (4 m) Länge. In »Scurilinges miri« (Schierlingssumpf, Schörmel) wohnte Gerolf. Er lieferte dem Kloster 20
Scheffel Gerste, 36 Scheffel Hafer, für Heerschilling und Heermalter 12 Pfennig. Feidiko in Elmenhorst ist wiederum nur zur Zahlung eines kleinen Betrages von 2 Sickel verpflichtet.
Wir wissen nicht, auf welche Weise das Kloster Werden zu seinem umfangreichen Besitz im Dreingau gekommen ist. Die Höfe sind wohl nicht von Bischof Liudger dem Kloster Werden als Erstausstattung
übergeben, könnten aber wohl von seinen Nachfolgern, den »Liudgeriden«, aus Familienbesitz überwiesen worden sein. Vielleicht wollte ein sächsischer Adliger durch die Schenkung der
Der Hof Geilern lieferte Tuche nach Werden, die wahrscheinlich in solchen Grubenhütten gewebt wurden. Rekonstruktion eines Grubenhauses auf dem »Sachsenhof« bei Greven nach den Ausgrabungen des
Museums für Archäologie (W. Finke) in Münster-Gittrup.
Sendenhorster Höfe sein Seelenheil sichern. Denn hundert Jahre nach den Sachsenkriegen war die christliche Lehre auf fruchtbaren Boden gefallen. Freie und Adlige wetteiferten in großzügigen
Schenkungen an die Kirche. Hömberg hat berechnet, daß um das Jahr 1000 ungefähr ein Drittel allen Grundbesitzes in Westfalen in kirchliche Hände übergegangen war. Einschließlich des Zehnten
beanspruchte die Kirche wenigstens 40% der Überschüsse aus bäuerlicher Arbeit 35).
Die Abgabehöhe in den Werdener Urbaren zeigt: es muß sich durchweg um große Höfe gehandelt haben. Wer, wie Gerolf im Schörmel, 20 Scheffel Gerste und 36 Scheffel Hafer liefern konnte, der muß über
Ackerflächen verfügen, die weit über das hinausgingen, was zum Lebensunterhalt einer bäuerlichen Familie notwendig war. Einige der Werdener Höfe, insbesondere Schörmel und Geilern, wird man sich wohl
als regelrechte Gutshöfe, ähnlich den in Warendorf ausgegrabenen, vorstellen müssen. Neben einem stattlichen Haupthaus gab es hier Vorratsgebäude, Hütten und Grubenhäuser für Gesinde und Handwerker.
Auf dem Hof Geilern wurden Tuche gewebt. Auf Geilern und auf dem Hof Arnolds (Bracht) gab es Mühlen, wahrscheinlich Handmühlen. Beide Höfe lieferten Mehl.
Der Besitz des Klosters Werden im Dreingau wurde vom Oberhof Werne aus verwaltet. Aber die Fernwege waren gefährlich und in einem schlechten Zustand. Selbst die regelmäßigen Lieferungen von
Sendenhorst nach Werne waren mühevoll und kaum zu leisten. Erst recht war der weite Weg von Werne ins Ruhrtal nach Werden schlecht zu begehen und noch schlechter zu befahren. Eine regelmäßige
Kontrolle der westfälischen Besitzungen war für das Kloster auf Dauer unmöglich. Werden mußte nach und nach den genauen Überblick über seine münsterländischen Besitzungen verlieren. Deshalb verkaufte
oder tauschte das Kloster die weit entfernten, schwer erreichbaren Höfe mit dem Bischof von Münster oder mit anderen Klöstern des Münsterlandes.
Zur Zeit des Abtes Wilhelm, um 1050, war Werdener Besitz in Sendenhorst stark geschrumpft. Die Abgabelisten verzeichnen noch folgende Pflichtige: Von Elmhurst Ezzelin Geldabgaben von 3 Schilling, 11
Pfennig und 1 Obulus. In »Rinchove« (Rinkhöven) Lentfried 20 Scheffel Malz; für den Heerschilling 8 Pfennig; Hühner und Wein werden mit Geld abgelöst. Burchard auf der »Hare« (Hardt) 2 Scheffel
Weizen, 12 Pfennig und 2 Schafböcke, ersatzweise 16 Pfennig, dazu den Heerschilling. Arbeitsleistungen, Wein und Hühner hatte er mit ein paar Pfennigen abzugelten. Folcmar auf der Hardt gibt 20
Scheffel Hafer, 10 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Weizen, im übrigen wie sein Nachbar Burchard. Zu dieser Zeit, in der Mitte des 12. Jahrhunderts, hatte Werden einige Ländereien gegen Lieferung von
Hafer und Gerste verpachtet. Benno zum Hemme (frühere Bauerschaft im Südwesten der Bracht, auf der Grenze von Ahlen und Sendenhorst), Tiemo zu »Wis« (Wiesch, Wiese; Bracht), Gerburg zu »Sindenhurst«,
der 8 Scheffel Hafer zu zahlen hatte. Damit enden die Nachrichten über Werdener Besitz in Sendenhorst. Zwar hatte das Kloster noch im 15./16. Jahrhundert Lehngüter in Albersloh, Alverskirchen,
Drensteinfurt, Westkirchen, Freckenhorst und Warendorf, aber nicht mehr in unserer Gemeinde. Die zahlreichen Werdener Höfe des frühen Mittelalters waren entfremdet, getauscht oder verkauft
worden.
Freckenhorst und Überwasser/MS
Freckenhorster Höfe - Güter des Klosters Überwasser in Sendenhorst
Die Geschichte des adligen Damenstifts Freckenhorst geht bis in die Frühzeit des Christentums in Westfalen zurück. Um 860 gründeten der Edelherr Everhard und seine Frau Geva an belebter,
verkehrsreicher Stelle, eine Wegstunde südlich der Burg Warendorf, ein Frauenkloster. Die Stifter statteten ihre Gründung mit Grundbesitz und abhängigen Höfen im Umfeld des Klosters reich aus. In der
Blütezeit besaß Freckenhorst mehr als 200 abhängige Höfe. Die Stiftung entwickelte sich zu einer Versorgungsstätte für Töchter edelfreier Familien. Später wurden auch Töchter des münsterschen Adels
aufgenommen.
Gerichtsbarkeit und Waffenhandwerk waren nach Kirchenrecht den frommen Schwestern wie allen übrigen Klosterinsassen untersagt. Hierfür wurde ein weltlicher Statthalter, ein Vogt, bestellt, der für
seine Leistungen von den Freckenhorster Bauern die Vogteiabgaben fordern konnte. 1170 ist Widukind von Rheda Stiftsvogt, gefolgt von dem Edelherrn Bernhard von der Lippe. Seit 1365 besitzen die
Grafen von Tecklenburg das Amt. Alle drei Familien beanspruchten Vogteirechte über Freckenhorster Besitzungen in Sendenhorst. Sie erscheinen mehrfach in Urkunden. In fast allen Sendenhorster
Bauerschaften war Freckenhorst mit Grundbesitz vertreten. Obwohl erst um 1090 aufgeschrieben, könnten die Sendenhorster Höfe des Stifts durchaus zur Erstausstattung des Klosters gehören. Eine spätere
Schenkung durch irgendeine heimische Adelsfamilie ist allerdings nicht auszuschließen.
Um 1090 - Aus der ältesten Freckenhorster Heberolle
An das Amt Vehus
Van Sendinhurst van themo Deddesconhus en gimalan malt gerston, 20 mudde haveron
An das Amt Balhorn
Van Brath (Bracht) Deiko tuenthi muddi gerston
Van Rammashuvila (Ramshövel, später Bracht) Azelin tein muddi gerston end tein muddi haveron
Van Astrammashuvila (Ostramshövel) Mannikin thritihe muddi gerston
Van thero harth (Hardt) ses muddi rockon ende nigon muddi gerston
Liudger an themo selvon tharpa nigon muddi gerston
Van Seandforda (Sandfurt) Rothard fierthihe muddi haveron
Buniken an themo selvon tharpa thritich muddi haveron
Van den Luckissconhus (Wüstung bei Elmenhorst) Fretheko en gerstin malt gimalan end thri malt gerston end sivon muddi
Van West Judinashuvila (West-Jönsthövel) en gimalan malt ende tuentich muddi gerston
Emma an themo selvon tharpa ses muddi rockon ende ses malt muddi maltes
Ibiko an themo selvon tharpa en gerstin malt gimala ende en mal gerston
Makko an themo selvon tharpa tuentich muddi gerston
Anmerkung: Die Sendenhorst betreffenden Abschnitte werden im Originaltext gebracht. Mittelalterliche Register und Verzeichnisse wurden ausschließlich in lateinischer Sprache niedergeschrieben. Der
altniederdeutsche Freckenhorster Text ist deshalb ein einzigartiges Sprachdokument. Die Verwandtschaft des Niederdeutschen mit dem Englischen ist deutlich zu erkennen. Einige Worterklärungen: Mudde
und Malt = Getreidemaße; gerston = Gerste, rockon = Roggen, haveron = Hafer; Zahlen: en = 1, thri = 3, ses = 6, seven = 7, nigon = 9, tein = 10, thirtich = 30, fiertihe = 40, an themo selvon tharpa =
aus derselben Siedlung (Dorf).
Güter des Klosters Überwasser in Sendenhorst
1040 gründete Bischof Hermann von Münster in seiner Bischofsstadt jenseits der Aa (trans Aquas, über dem Wasser, Overwater) ein adliges Frauenstift mit einer der hl. Maria geweihten Kirche. Erste
Äbtissin wurde Hermanns Schwester Betheithe. Auf einer glanzvollen Fürstenversammlung, im Beisein Kaiser Heinrich III., wurde die Kirche zum Jahresende 1040 eingeweiht. Bischof Hermann stattete seine
Gründung großzügig mit Grundbesitz aus. Die Marienkirche wurde zweite Pfarrkirche Münsters. Die edelfreie Äbtissin umgab sich mit einer Dienstmannschaft, die mit Stiftsgut belehnt wurde. Der
Grundbesitz, soweit nicht an ritterliche Dienstmannen auf Lebenszeit verliehen, wurde teils von Münster, teils von zentralen Verwaltungsstellen, den Oberhöfen, bewirtschaftet. Ungefähr fünfzig Jahre
nach der Gründung legte Überwasser ein Besitzverzeichnis an, in dem auch Güter in Sendenhorst aufgeführt werden. Es spricht vieles dafür, daß diese Höfe in der Bauerschaft Elmenhorst bereits zur
Erstausstattung des Klosters gehörten. Der Sendenhorster Besitz wurde zu dem Hofesverband Elmenhorst zusammengefaßt 36). Im 11. Jahrhundert, zur Zeit der Gründung von Überwasser, war es eigentlich
nicht mehr üblich, Grundbesitz zu einem Hofesverband zusammenzuschließen und von einem Meier oder Schulten verwalten zu lassen. Das System funktionierte nicht mehr. Die unfreien Verwalter arbeiteten
auf eigene Rechnung, strebten ehrgeizig danach, in den Stand der Dienstmannen aufzurücken und die Dienste und Abgaben der Bauern, die sie im Auftrag einziehen sollten, für eine eigene Herrschaft zu
benutzen.
Trotzdem verwaltete Überwasser seine Sendenhorster Höfe nicht von der Zentrale Münster aus - das wäre vernünftig gewesen -, sondern beließ es bei einem Verwalter, einem »Villicus«, der sich
mittlerweile als »adlig« verstand. Wie zu befürchten, behandelten die adligen Verwalter - seit dem 14. Jahrhundert die Familie Bock auf dem Albersloher Hof Grevinghoff (Bünker, Storp) - den
Hofesverband Elmenhorst wie ihr Eigentum, das sie beliebig für ihren eigenen Bedarf nutzten. Bis 1600 mußte das Kloster Überwasser zufrieden sein, wenn ein neuer Villicus (Verwalter) den Treueeid
ablegte und eine einmalige Gebühr zahlte. 1598 starb der Villicus Heinrich Buck zu Grevinghoff ohne leibliche Erben, ein unerwarteter Glücksfall für die adligen Damen von Überwasser. Jetzt konnten
sie die Elmenhorster Güter wieder in eigene Verwaltung nehmen. Allerdings mußte Überwasser zunächst einen langwierigen Prozeß führen, denn die Erben wollten freiwillig nicht auf den profitablen
Hofesverband verzichten 37).
Die Stiftskirche Überwasser und Häuser an der Aa 1840 (F. W. Harsewinkel).
Der Hofesverband Elmenhorst, übrigens die einzige Villikation auf Sendenhorster Gebiet, war nicht sehr groß. Nach dem Verzeichnis von 1100 hatte der Haupthof, die »curia Helmenhorst«, vier
bewirtschaftete Höfe in Elmenhorst und einen in Warendorf unter sich, die zur Lieferung von Hafer, Roggen und Malz verpflichtet waren. In den Auewiesen der nahegelegenen Angel wurden Kühe geweidet.
Der Hofesverband hatte 36 Käse nach Münster zu liefern. Die wüste, unbesetzte Hove »Luckentharpe« wurde vom Villicus mitbewirtschaftet. Außerhalb des Elmenhorster Hofesverbandes stand der Hof
Kössentrup (Culsencthorpe) in der gleichnamigen Bauerschaft, später zu Brock gerechnet. Dieser Hof lieferte Malz und Hafer nach Münster
⇱ ⇖ ↑
Siedlungsbau im Zeitalter der Salier - Doppelhöfe - Sadelhöfe, die »Prinzipalisten« im Kirchspiel 40)
Doppelhöfe
Bis zum Jahre 1000 wuchs die Bevölkerung in Sendenhorst, wie überall in Westeuropa, stark an. Die Siedlungsforschung hat viele Untersuchungen angestellt, viele Indizien wie neue Siedlungsnamen,
Einschränkungen der Markennutzung, Reglementierung der gemeinsamen Hude, Bevölkerungsabwanderungen geprüft, um die Auswirkungen des Wachstums festzustellen. Trotzdem sind wir über den in dieser Zeit
einsetzenden Siedlungsausbau nur sehr bruchstückhaft unterrichtet. In der weitgehend schriftlichen Zeit berichtet keine erzählende Quelle über Rodungstätigkeit oder die Anlage neuer Höfe in unserem
Raum. Auch die Urkunden jener Zeit sind rar und befassen sich höchsten zufällig mit unserem Problem. Umso wichtiger ist es, den kleinsten Spuren und Hinweisen nachzugehen, um wenigstens ein paar
Schlaglichter auf den so wichtigen Vorgang der »Binnenkolonisation« werfen zu können. Einen Zugang zu dem Problem liefert die Beschäftigung mit dem System der Doppelhöfe. Überall im Münsterland
finden wir Höfepaare mit gleichem Namen, nur voneinander unterschieden durch den Zusatz Große (Grote) oder Kleine (Lütke) 39).
Es war grundherrliche Initiative, die um die Jahrhundertwende, zum Teil auch noch später, die Teilung eines Hofes veranlaßte. Auf Anordnung der weltlichen Herren - die kirchlichen Besitzer wurden
seltener aktiv - wurde die Anbaufläche eines Hofes geteilt und mit zwei selbständig wirtschaftenden Familien besetzt. Die Höfeteilung wurde möglich, weil die Ackerflächen durch Rodung größer geworden
waren, auch, weil sich die Ertragsfähigkeit des Bodens verbessert hatte. Die Landwirtschaft hatte Fortschritte gemacht, hatte endlich gelernt, weitgehend, wenn auch nicht immer, an den Hungersnöten
vorbei zu operieren, die Ernährung sicherzustellen. Und so konnte die Bevölkerung wachsen, langsam und stetig. Für den adligen Grundherrn, für Grafen, Edelherren, Äbte oder Bischöfe, war die Aussicht
verlockend, statt eines zinspflichtigen Bauern gleich zwei zu haben, doppelten Besitz und doppelte Einnahme. Deshalb schritt man zur Teilung, wobei beide neuen Höfe annähernd gleiche Größe erhielten.
Für Sendenhorst lassen sich heute noch acht Doppelhofpaare, also 16 Höfe, die durch Teilung entstanden sind, nachweisen. Zum Teil ist eine Identifizierung nur nach Urkunden und alten Heberegistern
möglich. Die Höfe verteilen sich über das gesamte Kirchspiel. Eine Häufung in bestimmten Bauerschaften ist nicht zu erkennen.
Doppelhöfe
|
Name
|
Jahr
|
älteste Namensform
|
erster bekannter Grundherr
|
|
Bracht
Große Kogge
Lütke Kogge
|
1498
1498
|
Johan to Rameshovel
Johan Kogge
|
Freckenhorst
Familie von der Heghe
|
|
Schulze Horstrup
Lütke Horstrup++
|
1363
1447
|
Hove to Horstop
Luttikenhorstorpe
|
Freckenhorst, Lehen
Familie Brockhagen
|
|
Brock
Kösendrup
Rötgermann
|
1100
1363
|
Culsinctorpe
Lutke Culsinctorp
|
Bischof, Lehen
Überwasser
|
|
Elmenhorst
Hinsenbrock++
Ahland
|
1320
1320
|
domus Hilsincbroke
parva domus Hils.
|
Bischof
Hinrich Travelmann (1458)
|
|
Hardt
Grote Düveler
Lütke Düveler
|
1498
1498
|
Grote Dovelhover
Lütke Dovelhover
|
Heinrich Ledebur (1603)
Caspara Schenking (1603)
|
|
Middelhove
Grieskamp
Geilern
Schmetkamp
|
1511
1511
880
1502
|
Groite Middelhove
Luttike Middelhove
Gesandron
Luttike Geiseldorn
|
Kloster Vischbeck (1329)
Familie von der Heghe
Kloster Werden
Bischof
|
|
Rinkhöven
Vrede
Lütkehaus
|
1492
1437
|
Grotehuß
Luttekehues
|
Alter Dom, Münster
Wessel von Husen (1437)
|
Die Sadelhöfe, die »Prinzipalisten« im Kirchspiel
Einem weiteren Hinweis sollten wir nachgehen, um den Vorgang des Siedlungsausbaus genauer zu fassen, der Bezeichnung »Sadelhof« für eine Gruppe von Bauernhöfen, die sich auf den ersten Blick von
ihren Nachbarhöfen überhaupt nicht unterscheiden. Die Sadelhöfe sind wie alle Höfe im Besitz eines geistlichen oder weltlichen Grundherrn. Sie müssen zusammen mit allen Höfen des Kirchspiels die
öffentlichen Lasten, Steuern und Kirchspielsbeschwer tragen. Aber die Sadelhöfe haben eine Sonderstellung, wenn es darum geht, Abgaben an Küster und Pastor zu zahlen. Alle Vollhöfe liefern dem
Kirchherrn, dem Pfarrer, jährlich einen Scheffel Meßgerste. Nicht so die Sadelhöfe. Sie sind von Pfarr- und Küsterabgaben befreit. In neuerer Zeit, nach den großen Kriegen, mußten sie einmal im Jahr
für den Pastor einen halben Tag Mist fahren.
Die Sadelhöfe unterscheiden sich von den übrigen Höfen auch durch die Lage ihrer Hofesländereien. Blockartig, so als habe die Flurbereinigung schon in mittelalterlicher Zeit stattgefunden, lagern
sich die Äcker und Weiden um die Hofesstelle. Eine Gemengelage der Grundstücke mit anderen Höfen kommt bei den Sadelhöfen nicht vor, es sei denn, die Grundstücke sind später getauscht worden. Aus der
Sonderstellung gegenüber dem Pfarrer, vor allem aus den vorherrschenden Blockfluren hat die Forschung auf Gründung der Sadelhöfe durch mächtige
Mittelalterlicher Siedlungsausbau: Doppelhöfe (Häuserpaar): 1 = Große Kogge/Lütke Kogge; 2 = Schulze Horstrup/Lütke Horstrup; 3 = Kössendrup/Rötgermann; 4 = Hinsenbrock/Ahland; 5 = Große
Düveler/Lütke Düveler; 6 = Middelhove/Grieskamp; 7 = Geilern/Schmetkamp; 8 = Vrede/Lütkehaus. Sadelhöfe (einzelnes Haus): 1 = Schulte Tergeist; 2 = Schulte Bernd; 3 = Schulte Henrich; 4 = Schulte
Bockholt; 5 = Schulte Northoff; 6 = Schulte Elmenhorst; 7 = Vrede (auch Doppelhof); 8 = Ottenloh; 9 = Kleikamp; 10 = Schürmann; 11 = Schulte Horstrup (auch Doppelhof); 12 = Schulte Bering; 13 = Wisch
(Haus zur Wiese).
Herren, durch Grafen, Herzöge, Könige im 10. Jahrhundert schließen wollen. Aber auch eine Anlage durch die fränkischen Eroberer im Lauf des 9. Jahrhunderts wird nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall
steht hinter den Sadelhöfen planvolle Gründung einflußreicher, mächtiger Grundherren. Die Sadelhöfe bilden einen wichtigen Markstein auf dem Wege von der ungestalteten Wildnis zur ausgebauten
Kulturlandschaft. Über Namen und Abgaben der Sadelhöfe notiert Pastor Balthasar Raden:
1711 Registrum seu specifica designatio derer also genannten und im Kirchspiel Sendenhorst belegenen Saedelhöfe, welche von altersher, laut ihrer selbsteigenen Bekenntnisse, schuldig und verpflichtet
sind, dem zeitlichen Pastori zu Sendenhorst jährlich einen halben Tag Mist zu fahren.
In der Stadt Sendenhorst
Schulte tor Geist
In der Bröcker Bauerschaft
Schulte Berndt und Schulte Henrich
In der Sandtfurter Bauerschaft
Schulte Bockholt und Schulte Northoff
In der Elmenhorster Bauerschaft
Schulte Elmenhorst
In der Rinckhöver Bauerschaft
Vrede, Ottenloh, Kleikamp, item Schürmann, welcher letztere wüst ist
In der Brächter Bauerschaft
Schulte Horstrup
In der Jonsthöveler Bauerschaft
Schulte Bering
Aus älteren Registern geht außerdem hervor, daß auch »de Wyssch«, das Haus zur Wiese, in der Bauerschaft Bracht ursprünglich ein Sadelgut war.
Hohes Mittelalter
Herrschaften und staatliche Gewalten - Die Schröder von Ahlen und ihre Sendenhorster Freibauern - Sendenhorster Freistuhlgüter und Freischöffen
Herrschaften und staatliche Gewalten
Regionalgeschichte, erst recht Ortsgeschichte, hat mehrere Gesichter. Da gibt es die Herrschafts- und Verwaltungsgeschichte, die Geschichte der staatlichen Gewalt. Wir wissen nicht, wie weit sie von
den Sendenhorster Bauern überhaupt bewußt erfaßt und erfahren wurde. Grafen, Bischöfe, Könige, das waren ferne Mächte, die man im bäuerlichen Jahresablauf nur selten zur Kenntnis nahm. Wenn man aber
mit ihnen zu tun bekam, dann in der Regel unangenehm, störend, fordernd. Staatliche Gewalt brach meistens Abgaben und Leistungen verlangend, selten Hilfe und Schutz gewährend in den
ruhig-gleichbleibenden Ablauf des bäuerlichen Alltags ein.
Die andere Geschichte, das ist der Alltag, die schwere Arbeit, die Hungersnöte und Naturkatastrophen, aber auch die bescheidenen Freuden in der Familie und in den Nachbarschaften. Alltagsgeschichte
hat heute große Resonanz, stößt auf größeres Interesse als die traditionelle Staatsgeschichte, die Geschichte von Herrschern und Kriegen, von Verträgen und Vertragsbrüchen. Leider haben wir ein
grundsätzliches Problem. Die Quellen für die Geschichte des Alltags fließen sehr dünn, schweigen meistens. Wenn wir die Geschichte unseres Ortes darstellen wollen, können wir nicht mit der Frage
beginnen: Was wollen wir wissen? Sie müßte vielmehr lauten: Worüber können wir etwas erfahren? Es ist leider so, nur die Herrschaft, die staatliche oder grundherrliche Verwaltung schrieb und
urkundete. Die Masse der Bevölkerung blieb stumm. Eine Ortsgeschichte kann sich wohl darum bemühen, zwischen den Zeilen möglichst viel Alltag herauszulesen. Oft wird es aber nicht gelingen, die
Quellen geben es nicht her. Manchmal wird es möglich sein, aus dem, was über den bäuerlichen Alltag in anderen Gebieten Westfalens, in Deutschland, in Europa ermittelt wurde, Folgerungen für
Sendenhorst zu ziehen, um so ein ungefähres Bild vom Alltagsleben zu zeichnen. Im übrigen müssen wir die wenigen vorhandenen zufälligen und lückenhaften Quellen auswerten, so gut es eben geht. Aber
auch die Geschichte des heimischen Adels, der Gerichtsbarkeit, der Pfarrei – um nur ein paar durch Quellen abgesicherte Themen zu nennen – trägt ein wenig dazu bei, einen Einblick in die
Vergangenheit unseres Ortes und seiner Bewohner zu bekommen.
Sendenhorst lag im altsächsischen Dreingau. Die Gaue waren Siedlungsinseln, von den Nachbargauen durch unbewohnte Wald-, Heide- oder Sumpfgebiete getrennt. Der »pagus Dragini« (Dreingau) wird in der
fränkischen Kriegsberichterstattung für das Jahr 784 erstmalig erwähnt. In der Verwaltungsorganisation der Franken hatten die Gaue keinen Platz mehr. Die neuen Herren überzogen das eroberte
Sachsenland mit Grafschaften, Verwaltungs- und Gerichtsbezirken, mit einem beamteten Grafen an der Spitze. Im 10./11. Jahrhundert gelang es der mächtigen Familie von Werl, ein zusammenhängendes
Territorium von Grafschaften mit weitrechenden Rechten und Vollmachten in ihrer Hand zu vereinigen. Das Herrschaftsgebiet der Grafen von Werl reichte von der Nordsee bis ins Sauerland.
Das westfälische Kernland, der Dreingau nördlich der Lippe und der Brukterergau zwischen Ruhr und Lippe, gehörte um 1050 einem Grafen aus dem Hause Werl, der sich nach seiner Burg Hövel (Stadt Hamm)
Bernhard von Hövel nannte. Auf verschlungenen Wegen, über Erbtöchter, Nebenlinien und Teilungen, kam die Grafschaft Hövel mit den Gerichtsbezirken (Komitaten) Warendorf, Beckum, Ahlen, Rinkerode und
Sendenhorst an den Grafen Eberhard von Altena. 1175 verteilte er seinen Besitz im Münsterland an seine Söhne Arnold und Friedrich. Graf Arnold besaß die gräfliche Gewalt im Freigericht Ahlen und in
dem von Ahlen abgetrennten Gerichtsbezirk Sendenhorst. Die Verwaltung dieser beiden Freigrafschaften wurde der angesehenen Ministerialenfamilie von Ahlen übertragen .
Für die Sendenhorster Bauern, ganz gleich ob hörig oder persönlich frei, verkörperten die Herren von Ahlen zunächst Staatsgewalt und richterliche Autorität. Sie verfügten über die Gerichtsstühle in
und um Ahlen, vor Sendenhorst. Im Namen des Königs ließen sie Recht sprechen und Gütergeschäfte beglaubigen. Wichtig war, daß die von Ahlen die Verfügungsgewalt über die zum Freistuhl zugeordneten
Höfe hatten. Die sogenannten Stuhlfreien waren ja nicht wirklich frei im modernen Sinne, sondern standen unter dem Schutz ihres Gerichtsherrn. Der konnte über die Freigüter ziemlich willkürlich
verfügen, konnte sie, ohne den Bewirtschafter zu fragen, verkaufen oder vertauschen. Einzige Einschränkung: der freie Bewirtschafter eines Hofes durfte nicht mit verkauft werden. Seine Rechte an dem
Hof mußten entschädigt werden.
Die Schröder von Ahlen und ihre Sendenhorster Freibauern
Erst um das Jahr 1250 sind Angehörige der Familie von Ahlen genannt Schröder in der schriftlichen Überlieferung nachzuweisen. Sie müssen zu diesem Zeitpunkt bereits eine lange, bedeutende
Vergangenheit hinter sich haben. Denn bereits bei ihrem ersten Auftreten in den Urkunden befinden sie sich in angesehener, einflußreicher Stellung. Die Freibauern in den Freigrafschaften Ahlen und
Sendenhorst, die übrigen kleinen Adligen, der Bischof von Münster, sie alle hatten aus unterschiedlichen Gründen mit dieser Macht im südöstlichen Winkel des Bistums Münster zu rechnen. Eine
zusammenhängende geschichtliche Darstellung derer von Ahlen genannt Schröder gibt es bislang nicht. Weil die Familie für den Sendenhorster Raum eine wichtige Rolle spielte, ist es angebracht, sich
etwas näher mit ihr zu beschäftigen. Um es gleich vorweg zu sagen: Geschichte zu schreiben, nur mit Hilfe von mittelalterlichen Besitzwechselurkunden (das sind in der Regel die einzig verfügbaren
Quellen), bleibt unbefriedigend. Zu vieles ist Zufall, zu viele Fragen bleiben offen. Andererseits, diese meist lateinischen Urkunden sind das einzige, was wir aus mittelalterlicher Zeit haben. Und
noch eine weitere Einseitigkeit: Wieder ist es fast ausschließlich der Adel, der sich in diesen Urkunden zu Wort meldet. Er konnte Schulden mache, verkaufen, tauschen, er hatte Besitz. Der
Nichtadlige, erst recht wenn er mittellos war, hatte keine Geschichte. Wenn wir mit dieser Einschränkung die Urkunden untersuchen, stellen wir fest: es hat zwei Familien mit dem Namen »von Ahlen«
gegeben, die eine mit dem Leitnamen (Lieblingsvorname) Sveder, die andere mit dem Beinamen Schröder. Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Familien scheinen nicht bestanden zu haben,
jedenfalls lassen sich weder gemeinsame Vornamen, Wappen, Rechte oder Besitzungen nachweisen.
von Ahlen mit dem Leitnamen Sveder
1139 überträgt Bischof Werner von Münster die Kirchen von Ahlen und Werne an das Kloster Kappenberg. Unter der Dienstmannschaft, die diese Schenkung bezeugt, sind Sveder von Alen und Hermann von
Sendenhorst 3). Sveder (I.) war ein zuverlässiger Gefolgsmann der münsterschen Bischöfe. Im hohen Alter ging er als Laienbruder ins Kloster Liesborn 4). Sein Sohn ist mehrfach zwischen 1176 und 1199
im Gefolge münsterscher Bischöfe bezeugt 5). Von dessen drei Söhnen Lutbert, Everhard und Albert war Lutbert 1237 Gograf (Richter) von Ahlen 6).. Lutberts Sohn Rudolf trug den Beinamen »Longus« (der
Lange), ein Name, den ein Zweig der Familie von Ahlen im 14. Jahrhundert wiederholt benutzte 7).. Sveder von Alen erwarb das Bürgerrecht der Stadt Münster und war dort zwischen 1303 und 1306
Bürgermeister 8). Die weiteren Personen mit dem Namen von Ahlen sind nicht eindeutig einer bestimmten Familie zuzuordnen. Johann von Ahlen ist zuletzt 1425 als Verkäufer einer Rente bezeugt 9).
von Ahlen genannt Schröder
Um 1250 erwähnen die Quellen eine zweite Familie von Ahlen. Ritter Heinrich von Ahlen, Amtmann des Stifts Meschede, Pfandinhaber Vredener Güter in Borbein und Lehnsinhaber der Limburger
Freigrafschaft Ahlen-Sendenhorst, trägt als erster den merkwürdigen Beinamen Schröder 10). Das niederdeutsche Wort heißt Schneider, aber auch, zutreffender und für die Person eines kampferprobten
Ritters naheliegender, »Beißer, Der, der alles in kleine Stücke zerschlägt«.
Bei ihrem Eintritt in die geschriebene Geschichte hatten die Schröder von Ahlen den Höhepunkt ihrer Macht wohl schon überschritten. Zusammen mit anderen mächtigen Familien des Landes kämpften sie um
ihre Unabhängigkeit von dem Bischof von Münster, der seine Ansprüche als Landesherr flächendeckend durchsetzen wollte und schließlich sein Ziel auch erreichte. Die Auseinandersetzungen werden auf
beiden Seiten gewalttätig und mit fanatischer Zerstörungswut geführt. Schließlich behauptet der Bischof das Feld. Seine Gegner müssen sich geschlagen geben, die Ritter von Münster, von Bevern, von
Langen, von Lüdinghausen und natürlich die Herren von Ahlen. Einen bedeutenden Sieg über die Adelsopposition konnte Bischof Everhard 1276 verbuchen. Er zog gegen die gut befestigte, weitläufige Burg
Langen an der Bever, im Kirchspiel Westbevern nördlich von Telgte, und bezwang sie. Die Befestigungen wurden niedergerissen, die Gebäude und die dabei liegende Mühle zerstört. In der Landesburg
Wolbeck müssen die Unterlegenen sich dem Diktat des siegreichen Bischofs unterwerfen. Raub, Brandstiftung und Landfriedensbruch wirft der Bischof dem Burgherrn Hermann von Langen und seinen Helfern
vor. Mehr als 30 Ritter und Knappen des Bistums verpflichten sich als Bürgen für die Unterwerfung des aufsässigen Adels. Die Grafen von der Mark, von Bentheim und Tecklenburg und der Bischof von
Osnabrück wohnen dem Ereignis bei. Zunächst muß Ritter Hermann von Langen sich verpflichten, Burg und Mühle nicht wieder aufzubauen. Dazu muß er 200 Mark Buße zahlen, ein hoher Betrag, für den man zu
jener Zeit einen Hofesverband mit mehreren Unterhöfen kaufen konnte 11).
An diesem denkwürdigen 21. August 1276 steht auch Ritter Heinrich Schröder von Ahlen in Wolbeck vor seinem geistlichen Oberhirten. Bischof, Grafen und Dienstmannen sprechen ihn schuldig, dem Stift
Münster Schaden und Unrecht zugefügt zu haben. Heinrich gibt sich bezwungen, schwört Urfehde und gelobt, in Zukunft auf jede Gewaltanwendung zu verzichten. Zu dem Unterwerfungsakt ist seine gesamte
Familie in Wolbeck erschienen, seine Frau Elisabeth, Sohn Hermann und Schwiegertochter Reglandis, seine Töchter Gostia und Mechthild sowie sein Enkel Gerhard. Zur Sühne müssen die Schröder ihre
Gerichtsbarkeit, die Gogerichte, im südlichen Teil des heutigen Kreises Warendorf in folgenden Kirchspielen abtreten: Ahlen, Beckum, Vellern, Ostenfelde, Westkirchen, Ennigerloh, Vorhelm, Walstedde,
Heessen, Dolberg, Üntrop (= Lütke Üntrop nördlich der Lippe), Lippborg und halb Sünninghausen 12).
Für Bischof Everhard bedeutete der Erwerb der Gogerichtsbarkeit in knapp einem Dutzend Pfarreien ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur unumschränkten Landesherrschaft. Gerade in dieser Zeit
waren die Gogerichte im Begriff, sich von Niedergerichten mit begrenzter Befugnis zu den eigentlichen Hauptgerichten mit Verfügbarkeit über Leib und Leben zu entwickeln. In Zukunft richteten auch im
Südosten des Bistums nicht mehr eigenständige Adelige, sondern vom Bischof bestellte, von ihm abhängige Richter. Der Familie Schröder blieb die Freigerichtsbarkeit, als Lehen der Grafen von Limburg
der Gewalt des Bischofs entzogen. An den Freistühlen vor den Toren der Stadt Ahlen, vor der Stadt Sendenhorst, in der Bauerschaft Östrich, richteten und urkundeten Freigrafen im Namen derer von Ahlen
genannt Schröder. Besonders wichtige Geschäfte ließen die Gerichtsherren von sämtlichen zur Schröderschen Freigrafschaft gehörigen Freibauern bezeugen.
1269 führte Ritter Heinrich von Ahlen ein schwieriges Gütergeschäft durch, das durch fünf Beurkundungen abgesichert wurde, und die Bestätigung durch alle Freibauern notwendig machte. Ritter Heinrich
verkaufte zwei Höfe in Schmehausen (Smidehusen), einen in Lippborg und einen Kotten bei Lippborg sowie die Fischerei auf der Lippe an das Kloster Welver. Die Häuser gehörten zu seiner Freigrafschaft.
Deshalb mußte der freie Bewirtschafter ein Ersatzgut erhalten und Graf Dietrich von Limburg, Eigentümer der Freigrafschaft, durch ein anderes Gut, das Haus Berichem, entschädigt werden. Unter den
Zeugen befinden sich auch drei Freibauern aus Sendenhorst: Johannes de Rinchove (entweder Greive oder Suermann in Rinkhöven), Johannes Bruninc (Bewirtschafter des späteren Hofes Niesmann, Bracht) und
Ludolfus de Rameshuvele (Heimann, Bracht) 13).
Ritter Heinrichs Sohn Hermann war wie bereits sein Vater gezwungen, Höfe oder Grundstücke zu veräußern. Großzügig übersah er bei den Verkäufen, daß es sich um Freistuhlgut handelte, das eigentlich
nur mit Zustimmung der Grafen von Limburg verkauft werden durfte 14). 1318 verkauft Knappe Heinrich genannt Schröder mit Zustimmung sämtlicher erbberechtigten Verwandten dem Kloster Kentrup vor Hamm
die Kusteshove in der Ahlener Bauerschaft Östrich. Zur feierlichen Verzichtsleistung vor dem Freistuhl hat Heinrich alle Freien seiner Freigrafschaft aufgeboten. Überrascht lesen wir, daß allein aus
Sendenhorst zwölf Freibauern erschienen sind. Im Jahrhundert der Stadtgründung gab es also in der Stadtfeldmark und im Kirchspiel noch überdurchschnittlich viele von freien Leuten bewirtschaftete
Höfe 15).
Sendenhorster Freistuhlgüter und Freischöffen 1269-1340
|
Jahr
|
Freischöffe
|
Bauerschaft
|
Verkauf
|
späterer Besitzer
|
Name des Hofes
|
|
1269
1269
1312
1312
1312
1318
1318
1318
1318
1318
1340
|
Johann v. Rynchoven
Johann Bruninc
Levold v. Kulsinctorpe
Albert Levekinc
Herman de Hertoghe
Herman v. Righove
Reynken v. Meldinchoven
Johan v. Egelbertyng
Herman Hobeltrey
Johann Hoykeman
Herman v. Schegtorpe
|
Rinkhöven
Bracht
Brock
Stadt
Bracht
Rinkhöven
Hardt
Hardt
Bracht
Bracht
Rinkhöven
|
vor 1340
1367
?
vor 1340
1367
|
Domkapitel
Bisch. Lehen
Bisch. Lehen
Fraterherren
mstr. Bürger
Domkapitel
Domkapitel
Bischof
bleibt Freigut
Bisch. Lehen
Fraterherren
|
Greive
Niesmann
Hove Kulsinctorp
Flur Leringbrock
Hoppe
Suermann
Mellinghoff
Watermann
Heimann
Rotkötter
wüst, bei Brüser
|
⇱ ⇖ ↑
Der heimische Adel im 12. Jahrhundert
Hermann von Sendenhorst - von Schorlemer (Bild: Wappen der Schorlemer)
Hermann von Sendenhorst
Im 12. Jahrhundert bildete sich ein adliger Kriegerstand als neue, privilegierte Schicht heraus. Ursprünglich unfrei, dann aber auf den Italienzügen der Könige, den Kriegen der geistlichen und
weltlichen Großen, vor allem auf den Kreuzzügen als unentbehrliche Helfer sozial aufgestiegen, schob sich dieser neue Stand nach und nach zwischen Bauerntum und hohem Adel. Diese Dienstmannen oder
Ministeriale wurden auch für den Bischof von Münster wichtige Stütze zur Machterhaltung und zum Machtausbau, innen und außen. Sie waren seine Begleiter zur Pfalz des Königs, auf dem Weg in das
Heilige Land oder bei seinen Reisen durch das Bistum.
Die Beurkundung von Rechtsgeschäften, von Schenkungen oder Verkäufen ist zu dieser Zeit noch nicht die Regel. So wundert es nicht, daß wir über einen Sendenhorster Adel des 10./11. Jahrhunderts gar
nicht, über den des 12. Jahrhunderts nur unzulänglich unterrichtet sind. Aber sicherlich hat es sie ebenfalls in Sendenhorst gegeben, die ritterlichen Krieger im Dienste des Bischofs oder anderer
Großer, auch wenn die spärlichen schriftlichen Quellen wenig hergeben. In dem Jahrzehnt zwischen 1133 und 1142 reist Hermann von Sendenhorst im Gefolge des Bischof Werner. Er bezeugt 1139 eine
bedeutende Schenkung, die Übertragung der bischöflichen Kirchen Werne und Ahlen an das wenige Jahre vorher gegründete Prämonstratenserkloster Kappenberg. Hermann urkundet zusammen mit anderen
bekannten münsterschen Dienstmannen, mit den Herren von Dülmen, von Meinhövel, Bevern und Ahlen19. Die Kennzeichnung durch den Ortsnamen Sendenhorst deutet auf einen festen Sitz, vielleicht sogar
eine Burg, hin. Man möchte Hermann von Sendenhorst in Zusammenhang bringen mit den gewaltigen Mauerfundamenten, Resten eine Burg des 12. Jahrhunderts, die 1975 beim Bau des Bürgerhauses ans
Tageslicht kamen20. Leider versinkt die weitere Geschichte derer von Sendenhorst nach 1142 wieder im Dunkel der schriftlosen Zeit 21)
von Schorlemer
Das Werdener Gut im »Scurilingis miri«, im Schierlingsumpf, wurde im 12. Jahrhundert namengebend für eine Familie, die zwar in Sendenhorster Urkunden keine Spuren hinterlassen hat, die aber um so
größere Bedeutung außerhalb des Münsterlandes erlangte. Die Familie von Schorlemer hat ohne Zweifel ihren Ursprung und Stammsitz im Schörmel nordöstlich der Siedlung Sendenhorst22). Zum
Schutz gegen feindliche Überfälle errichteten die Schorlemers inmitten ihrer Sendenhorster Güter eine Turmhügelburg, eine »Motte«. Das war die bis ins 13. Jahrhundert hinein übliche Art des
Burgenbaus: In der Talaue der Angel wurde ein kreisrunder Hügel aufgeworfen, ringsum mit einem Wassergraben umzogen und mit Palisaden und einem festen Blockhaus gesichert 23) Die
Schorlemers suchten Verdienst und Auskommen bei auswärtigen Herren. Sie mieden das Dienstverhältnis zu ihrem bischöflichen Landesherrn. So nennen die Urkunden sie als Ritter und Burgmannen im Gefolge
der Grafen von Arnsberg und Ravensberg. Genau wie hundert Jahre später ostwestfälische Adelsfamilien, wie die Retberg und von Quernheim, in den Sendenhorster Raum einsickern und hier seßhaft und
begütert werden, genauso drängen die Schorlemers aus Sendenhorst hinaus nach Süd- und Nordosten. Sie erwerben Güter in der Umgebung von Soest und Lippstadt, werden Bürger von Soest, Lippstadt, Geseke
und Osnabrück.
Bis ins 13. Jahrhundert schützte sich der Adel durch »Motten«, Turmhügelburgen.
Der »Knapp« auf der Knappwiese ist zweifellos, trotz seiner ungewöhnlichen rechteckigen Form, der Rest einer Turmhügelburg der Schorlemer. Die Anlage liegt in einer Bachschleife der Angel, dem
»Großen Hof«. eine frühmittelalterliche Wallburg ist nicht auszuschließen.
Die Schorlemers waren mit der Familie von Warendorf versippt. Beide Familien waren maßgeblich an der Kolonisation und Besiedlung des Raumes zwischen Elbe und Ostsee beteiligt. Von Giselbert von
Warendorf wissen wir, daß er zu dem Konsortium von Fernhandelskaufleuten und Adligen gehörte, das 1156 Lübeck gründete. Ludolf und Reinfried von Schorlemer sind Ende des 12. Jahrhunderts in
angesehener Stellung als Truchsessen, Amtmänner oder Drosten der Grafen von Ratzeburg südlich von Lübeck. Reinfried, der Jüngere, war ein erfolgreicher Siedlungsunternehmer, ein »Lokator«, der im
Auftrage seines gräflichen Herren Dörfler plante, Siedler anwarb und Ackerland zuwies. Man kann annehmen, daß Reinfried auch Siedlungswillige aus der Stammheimat seiner Familie, aus Sendenhorst,
anwarb. Auf jeden Fall kam die Mehrheit der Siedler aus Westfalen. In dem von slawischen Wenden nur dünn besiedelten Gebiet gründete Reinfried von Schorlemer nicht weniger als zehn Dörfer, bei
Lauenburg, bei Schwarzenbeck, am Schaalsee und südlich von Lübeck.
Als Kriegsmannen stritten die Schorlemer auf der Seite der Grafen von Holstein gegen die Dänen. Reinfried von Schorlemer kämpfte im Aufgebot der norddeutschen Fürsten, die am 22. Juli 1227 dem
Dänenkönig Waldemar II. bei Bornhöved (südlich Bad Segeberg) eine vernichtende Niederlage verschafften. Bornhöved beschränkte die dänische Herrschaft auf die Eidergrenze. In einem ersten Vertrag
bürgte Reinfried zusammen mit dem Grafen von Schwerin gegenüber dem gefangenen Dänenkönig. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts treffen wir Mitglieder der Familie Schorlemer in Lübeck, letztmalig 1296
Reynfridus Scorlemorle 24). Die weitere Geschichte der Schorlemer kann nicht Gegenstand dieser Ortsgeschichte sein. Erwähnt werden sollte jedoch ein bedeutender Vertreter dieser ursprünglich
Sendenhorster Familie, Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst (1825-1895), Zentrumspolitiker und engagierter Verfechter bäuerlicher Interessen. Von Schorlemer-Alst gründete 1862 den Westfälischen
Bauernverein (»Bauernkönig«), war 1875-1887 Mitglied des Deutschen Reichstags und bemühte sich als Zentrumspolitiker während des Kulturkampfes um einen Ausgleich mit dem Staat 25)
Die westfälische Linie der Schorlemer von Fredehardskirchen führte im Wappen einen doppelt gezinnten Rechtbalken. Mit genau diesem Wappenbild siegeln im 14./15. Jahrhundert die Mitglieder einer
Familie mit dem Spitznamen Mule (= Maul). Die Mule weisen sich durch Wappengleichheit als bescheidene Vettern der erfolgreicheren Schorlemers aus. Es ist der in der Heimat verbliebene Familienzweig,
dem der ganz große soziale Aufstieg versagt blieb. Die Mules erscheinen vor allem in Urkunden, die Güter in der Bauerschaft Elmenhorst und in den Nachbarkirchspielen zum Inhalt haben. Vielleicht
haben sie in Elmenhorst gewohnt. Auf jeden Fall waren sie zeitweilig bischöfliche Richter und Burgmannen zu Wolbeck 26). Die ehemals selbständige Landgemeinde Sendenhorst, das Kirchspiel,
wählte 1938 das Wappen der Schorlemer-Mule für ihr Gemeindewappen, eine sicherlich sinnvolle Erinnerung an eines der großen Geschlechter des mittelalterlichen Sendenhorst 27)
Die Gründung der Stadt Sendenhorst
Im 12. Jahrhundert entwickelte sich in Westeuropa eine neuartige, fortschrittliche Form menschlichen Zusammenlebens: durch kaiserliche oder landesherrliche Privilegien aus dem bäuerlichen Umland
herausgehobene Marktzentren, die Städte. Kaufleute und Handwerker siedelten an verkehrsgünstigen Stellen oder in der Nähe von Dynasten- oder Domburgen, schlossen sich zu einer Schwurgemeinschaft
zusammen und bildeten die Bürgerschaft. Zäh und erfolgreich setzten die Bürger ihre Ansprüche auf Mitverwaltung, später auf völlige Autonomie, gegenüber ihrem Stadtherrn durch. Bis 1180 hatte Münster
den Weg von einer kleinen Marktsiedlung am Rande der Bischofsburg zur wichtigsten Stadt Westfalens durchlaufen28. Beckum und Ahlen, in der Nachbarschaft Sendenhorsts, waren seit 1200 auf dem Wege zur
Stadt. Um einen bischöflichen Haupthof, auf dem die Pfarrkirche stand, waren hier geschützte Siedlungen mit Marktfunktion entstanden, die sich Zug um Zug von den bischöflichen Landesherren Rechte und
Privilegien ertrotzten. Ahlen und Beckum waren zu dieser Zeit die wirtschaftlichen Zentren für das südöstliche Münsterland.
Die Verleihung der Stadtrechte erscheint uns heutigen Menschen unerheblich, ein formaler Verwaltungsakt ohne Konsequenzen. Seit der Verfassung der Neuzeit, den bürgerlichen Gesetzbüchern, den
Menschenrechtserklärungen, gilt der Grundsatz: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, unabhängig von Religion und Hautfarbe, unabhängig aber auch vom Wohnsitz, von Stadt oder Land. Das war nicht
immer so. Im Mittelalter wohnte die Masse der Bevölkerung auf dem Lande, war an die Scholle gebunden, in der Freizügigkeit eingeschränkt oder im Eigentum des Herrn. Nur wenige Freibauern und die
Bürger der Städte waren frei. Der Wohnsitz innerhalb der Mauern einer Stadt machte die Menschen frei, hob sie aus dem unfreien bäuerlichen Umland heraus.
Auch für die Handwerker und Händler, die sich rund um die Sendenhorster Kirche niedergelassen hatten, mußte eine Stadtrechtsverleihung für ihre kleine Siedlung verlockend und erstrebenswert sein.
Leider war der Ort zu unbedeutend, der Handel beschränkte sich auf den Warenaustausch mit den umliegenden Bauerschaften. Für ein weiteres städtisches Zentrum neben Beckum und Ahlen im Süden und
Osten, Telgte und Warendorf im Norden und Nordosten war in der Region absolut kein Bedarf. Und dennoch bekamen die Sendenhorster Stadtrechte.
Das Bischof Ludwig sich um 1315 entschloß, sein Kirchdorf Sendenhorst in den Rang einer Stadt zu erheben, hatte weniger wirtschaftliche als militärisch-politische Gründe. Um den Vorgang und seine
Begleitumstände zu verstehen, müssen wir an dieser Stelle ein kleines Kapitel münsterländische Landesgeschichte einschieben. Westfalen gehörte seit der Landnahmezeit des 7./8. Jahrhunderts zu
Sachsen. Im Herzogtum Sachsen machten sich seit Anfang des 12. Jahrhunderts Auflösungserscheinungen bemerkbar. Die geistlichen und weltlichen Herren Westfalens bauten ihren zunächst noch nicht
festumrissenen Herrschaftsbereich zu einem geschlossenen Territorium aus, zu einem Flächenstaat mit dem Herrschaftsanspruch über alle in dem Gebiet wohnenden Menschen. Auch die Bischöfe von Münster
strebten nach Landesherrschaft. Sie hatten ein klares Ziel vor Augen, ihren geistlichen Herrschaftsbezirk, die »parochia des Hl. Liudger«, das Bistum, zu einem weltlichen Territorium auszubauen. Am
Ende deckten sich Bistum und Fürstbistum. Zuständigkeitsbereich des Seelenhirten und des Landesherrn. Die Bischöfe von Münster führten sich schon um 1150 wie Herzöge in ihrem Bistum auf. Sie
beanspruchten für sich das Recht, die Gografen (Richter) zu ernennen29. Der Prozeß der Territorialisierung des Bistums Münster erstreckte sich über beinahe 200 Jahre und war von Fehden und Kriegen
mit den Nachbarn und mit den heimischen Edelherren begleitet. Seit 1200 war Münster jenseits der Lippe ein gefährlicher Gegner entstanden, die Herrschaft der Grafen von der Mark, die ihre Burg Mark
in der Nähe der Bistumsgrenze zu einem Mittelpunkt ausbauten und 1226 Hamm gründeten. Wenn die Märker auch ihre heftigsten Auseinandersetzungen mit den Erzbischöfen von Köln ausfochten, so gerieten
sie gegen Ende des 13. Jahrhunderts zunehmend stärker mit den Bischöfen von Münster aneinander. Noch war die Lippe nicht anerkannte Grenze zwischen den beiden Ländern.
Ein beliebtes Mittel der Herrschaftssicherung war die Anlage von Landesburgen, befestigte Plätze, die durch adlige Berufskrieger gesichert wurden. Aber die Unterhaltung dieser Burgen wurde immer
kostspieliger, ließ sich auf Dauer kaum noch aufrecht erhalten. Die Dienstmannen beanspruchten Güter und Geldeinnahmen auf Lebenszeit (Lehen), verstanden es sogar, einen Erbanspruch auf die Lehen
durchzusetzen. Die ritterlichen Landesverteidiger wurden den armen Bischöfen, die ja noch nicht über regelmäßige Steuereinnahmen verfügten, zu teuer. Billiger und wirksamer war es, statt der
Berufskrieger den jungen Bürgerstand zu militärischen Diensten heranzuziehen. Für das Privileg der Freizügigkeit und Selbstverwaltung waren Handwerker, Händler und Landwirte bereit, ihre Siedlung zu
befestigen und für ihren Bischof zu verteidigen. Und so kommt es seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu Stadtgründungen, die ökonomisch, als Marktzentren für eine größere Region, völlig
überflüssig waren und nur noch militärische Bedeutung haben. Die Verleihung städtischer Rechte an schon bestehende, dichter besiedelte Kirchorte war recht vorteilhaft. Es kostete dem Bischof nur eine
Pergamenturkunde, und schon hatte er einen zuverlässigen Stützpunkt, dessen Bürger bereit waren, ihr Eigentum und gleichzeitig die Interessen des Bischofs mit Waffen zu verteidigen. Wo konkurrierende
Nachbarn oder widerspenstige einheimische Adlige die Herrschaft gefährdeten, legten die Bischöfe kleine Städte an. Wenn so ein Städtchen auch nur ein sehr kleines Umfeld wirklich beherrschen konnte,
die Tatsache der Befestigung schreckte den Gegner meist ab.
Von der Möglichkeit, Städte aus strategischen Gründen zu errichten, machten die münsterschen Bischöfe seit 1300 verstärkt Gebrauch. Bischof Otto III. von Rietberg erklärte 1304, er wolle sein Dorf zu
Dülmen zu einem »stedikene«, einem Städtchen, erheben. Es blieb einem seiner Nachfolger, Bischof Ludwig von Hessen, vorbehalten, die Ankündigung wahrzumachen. Dülmen bekam 1311 Stadtrechte. Bischof
Ludwig ist der wichtigste Städtegründer dieser Zeit, und außer Dülmen verdanken ihm die Städte Ramsdorf, Rheine, Billerbeck und nicht zuletzt Sendenhorst ihre Entstehung30). Wer war dieser
Bischof, der sein Bistum fast ein halbes Jahrhundert regierte, woher kam er, wie regierte er?
Bild: Bischof Ludwig von Hessen, sitzend unter einen Baldachin: zu seiner Rechten der münstersche Balkenschild, zur Linken das hessische Löwenwappen (Siegel von 1310)
Ludwig entstammte einer Familie, die erst 1292 die Besitzgarantie für Hessen und den Aufstieg in den Reichsfürstenstand geschafft hatte. Seine Urgroßmutter war die hl. Elisabeth, die ungarische
Königstochter, die als Frau des Landgrafen von Thüringen auf der Wartburg und im benachbarten Eisenach ihr Leben für die Armen aufgeopfert hatte. Über ihrem Grab in Marburg hatte Landgraf Heinrich,
der Vater Ludwigs, den ersten Bau der Gotik in Deutschland, die Elisabethkirche, errichten lassen. Bevor der Papst in Avignon Ludwig 1310 als Bischof von Münster bestätigte, hatten sich mehrere
hochgestellte Persönlichkeiten bemüht, ihm eine standesgemäße geistliche Versorgung zu beschaffen. Der Bruder des französischen Königs vermittelte wegen einer Domherrenprähende in Mainz. Da zu der
Zeit keine Stelle frei war, mußte sich Ludwig mit einem Scholastikat begnügen. Der deutsche König Heinrich VII. forderte das Kölner Domkapitel auf, sich in Münster um eine Domherrenstelle zu bemühen.
Zu dem Zeitpunkt, als er durch Vermittlung seines Neffen Otto von Kleve endlich auf den Bischofsstuhl von Münster berufen wurde, war Ludwig Domherr in Chartres.
Die Vermittlung des münsterschen Bischofsstuhles war auch eine wirtschaftliche Transaktion, für die Ludwig die Beteiligten bezahlen mußte. Die päpstliche Kurie wollte für ihr Entgegenkommen die Taxe
von 3.000 Gulden. Graf Otto von Kleve erhielt die Pfandschaft und zeitweilige Verfügung über münstersche Ämter, Burgen und Gerichte31. Die hessischen Freunde bekamen einträgliche Pfründe an
münsterschen Kirchen32. Bischof Ludwig gab seine Verbindung zum heimatlichen Hessen niemals auf. Als Leibgedinge, zur persönlichen Verwaltung, war ihm die Stadt Marburg mit Biedenkopf und die Hälfte
des Amtes Wetter zugefallen33. Zeit seines Lebens kümmerte er sich um seine Stadt Marburg, um das väterliche Schloß, um die Elisabethkirche. Ingeborg Schack schreibt: »Bischof Ludwig ist ein guter
Hirte für Marburg gewesen, die Bauten seines Vaters und die Entwicklung der Stadt hat er mit gleicher Tatkraft gefördert … Nicht nur für die Vollendung des schon Begonnenen (der doppelgeschossige
Saalbau der Burg) sorgte sich der geistliche Herr, er kümmerte sich als guter Hausvater auch um die alltäglichen Bedürfnisse des Schlosses … Aus Ludwigs Regentenzeit, die durch die Bauten auf dem
Schloßberg und durch die Arbeiten an den mächtigen Türmen der Elisabethkirche gekennzeichnet ist, stammt die älteste Stadtrechtsurkunde von Marburg aus dem Jahre 1311 34)«.
Weil ihm Marburg zeitweilig genauso wichtig war wie Münster, reiste Ludwig häufig zwischen beiden Besitzungen. Der Fernweg von Münster in das Hessenland führte über Sendenhorst und Soest. Es ist sehr
wahrscheinlich, daß Ludwig in Sendenhorst rastete, daß er mit seinem Gefolge von oder nach Marburg Quartier nahm. Es ist nicht auszuschließen, daß die Lage Sendenhorsts an der Fernstraße
Münster-Soest Ludwig zur Stadterhebung veranlaßt hat. Im übrigen verhielt sich Bischof Ludwig so, wie man es von einem fürstlichen Herrn jener Zeit zu erwarten hatte. Er ließ sich in zahllose Kriege
und Fehden verwickeln, griff an oder wurde angegriffen, mal gegen die Nachbarn, mal gegen rebellische Herren des eigenen Landes. Damit setzte Ludwig die Politik seiner Vorgänger konsequent fort und
führte sie zu einem vorläufigen Abschluß. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts deckte sich das politische Herrschaftsgebiet der Bischöfe von Münster weitgehend mit den Grenzen der geistlichen
Jurisdiktion. Die münsterischen Bischofschroniken schildern seine Regierungszeit als eine ununterbrochene Folge von Fehden. Die Liste seiner Gegner ist lang.
Nach Darstellung des Chronisten legte sich Ludwig mit halb Europa an.
Bischof Ludwig
(Auszüge aus der münsterschen Bischofschronik)
Übersetzung der niederdeutschen Fassung)35 Ludwig von Hessen, der war einmalig rühmenswert. Er hielt eine freigiebige Tafel. Als Bischof Otto starb, war er ein staatlicher Jüngling und ein Kanoniker
zu Chartres in Frankreich. Ihm wurde die Kirche von Münster durch die Vermittlung Graf Ottos von Kleve von Papst Clemens V. übertragen. Er war der erste münstersche Bischof, der die Bestätigung durch
den Papst erhielt. Als Ludwig durch Otto von Kleve in sein Amt eingeführt wurde, da fand er seine Leute in guter Ordnung, Geistliche, Bürger, Dienstleute und Burgmannen fand er in Eintracht und dem
Heiligen Paul untertan. Und er regierte sein Land nach dem Rat des Grafen Otto ausgezeichnet. Er richtete streng. Seine Untertanen, die gegen ihn waren, bezwang er durch sein Gericht, durch Kampf und
Belagerung, durch Stürmung ihrer Burgen. Er führte auch mehr Kriege und Fehden als seine Vorgänger. Dadurch änderte sich seine Einstellung. Aber er blieb stets männlich und unerschrocken und
bereicherte sein Stift mit vielen Gerechtsamen. Er kaufte die Herrschaften Bredevort und Lohn. Er erbaute das Wigbold Ramsdorf und befestigte Rheine, was sein Vorgänger nicht vermocht hatte. Er
errichtete auch zwei Burgen, z. B. die Heidemühle. Als er eine Fehde mit dem Grafen von der Mark hatte, schlug er zwei Brücken über die Lippe und fügte dem Grafen großen Schaden zu. Aber schließlich
wurde er bei der Brücke vor Hamm mit wenigen Gefährten gefangen, weil die Hessen Pech hatten und unvorsichtig waren. Zum Glück kam er wieder frei. Während er in Gefangenschaft war, ging Haltern
verloren. Mit Mühe und Not bekam er den Ort durch den Herren Bitter zurück. Er nahm viele Feinde gefangen, warf sie in den Turm von Dülmen und forderte für sie Lösegeld. Darauf hatte er einen großen
Krieg mit … dem Graf von Geldern, dem König von Böhmen, dem König von Frankreich, den Bischöfen von Lüttich und Utrecht, den Grafen von Jülich, von der Mark, von Berg, von Flandern, von Holland, den
Herren von Steinfurt, dem Stift Osnabrück, den Grafen von Tecklenburg und Bentheim, von Oldenburg, von Hoya und Diepholz, von Arnsberg … Er hatte viele Kriege zu führen, große und kleine, lange und
kurze, alle um seiner Kirche willen. Zu seiner Zeit, als man schrieb das Jahr 1350, ging über die ganze Welt ein großes Sterben, so daß einer den anderen kaum begraben konnte oder daß der eine kaum
beim anderen bleiben konnte wegen der gräßlichen Seuche. In Münster starben an die 11.000 [!?] Menschen. Die Leute nennen die Seuche den Großen Tod. Überall wurden die Juden getötet, denn man gab
ihnen die Schuld an der Seuche. Ludwig starb, als man schrieb 1357, im 49. Jahr seines Bischofsamt auf St.-Agapitustag [18. August], und am St. Bartholomäustag wurde er begraben.


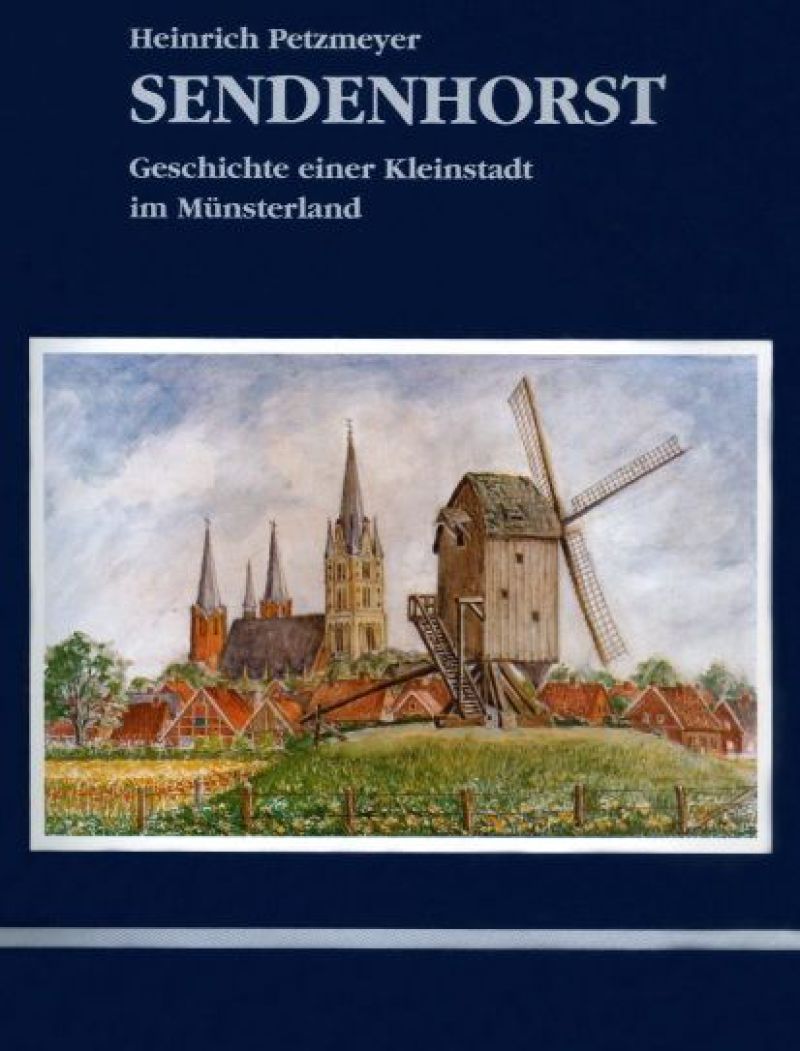
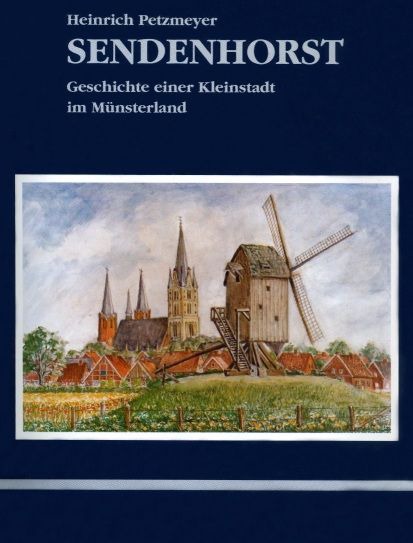
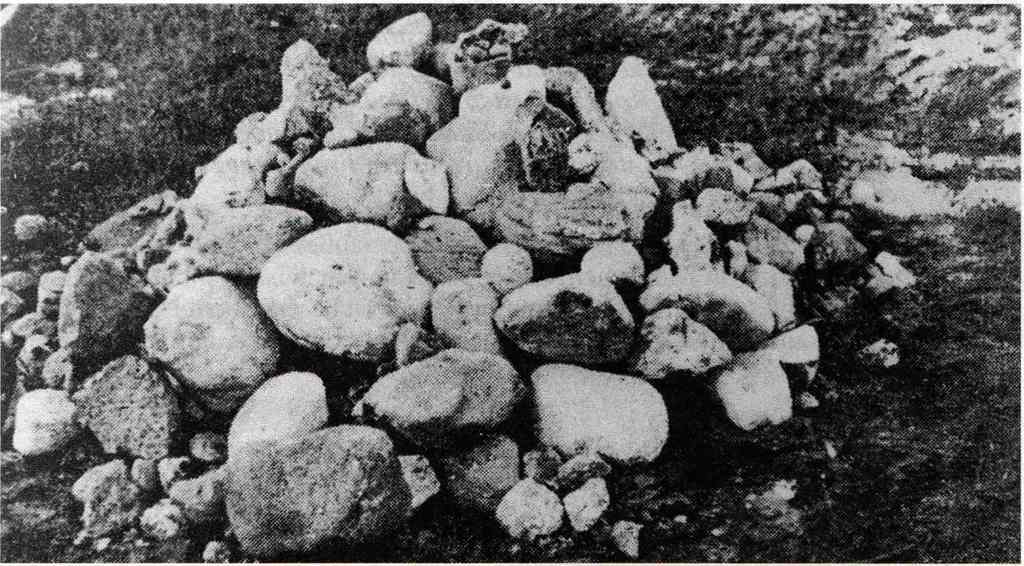
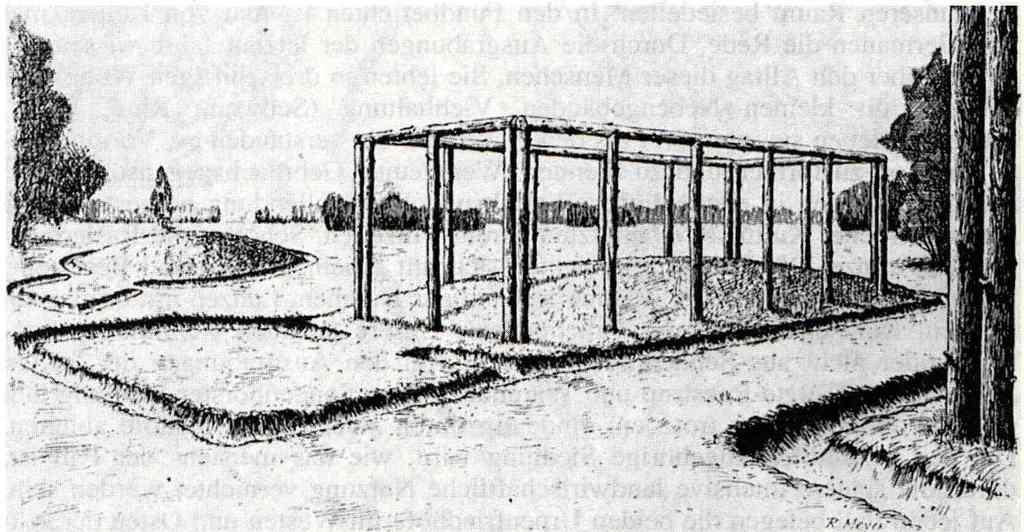 Bild:
Bild: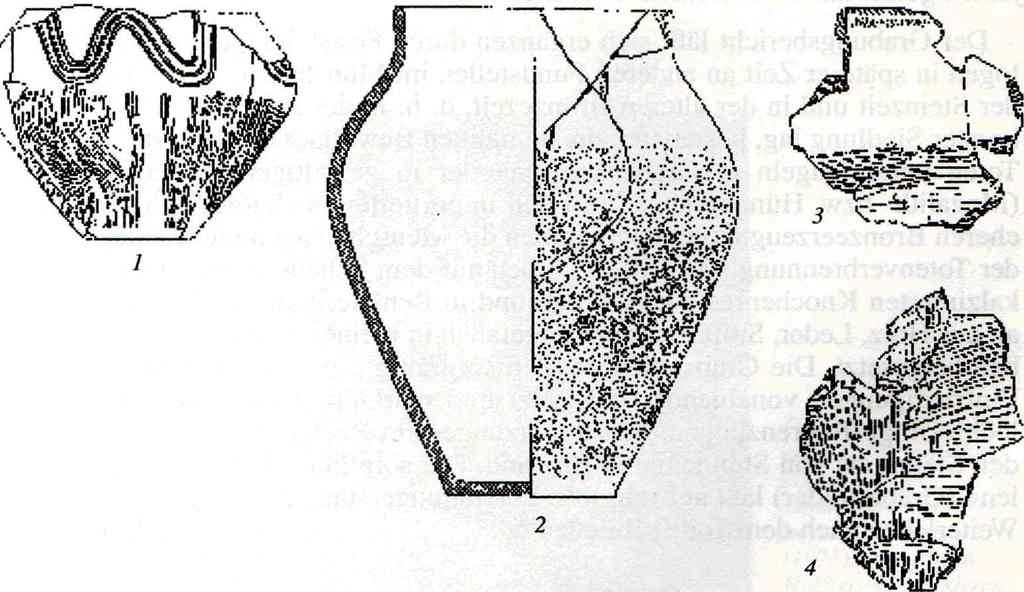 Bild:
Bild: Bild:
Bild: Bild [red. ergänzt]:
Bild [red. ergänzt]: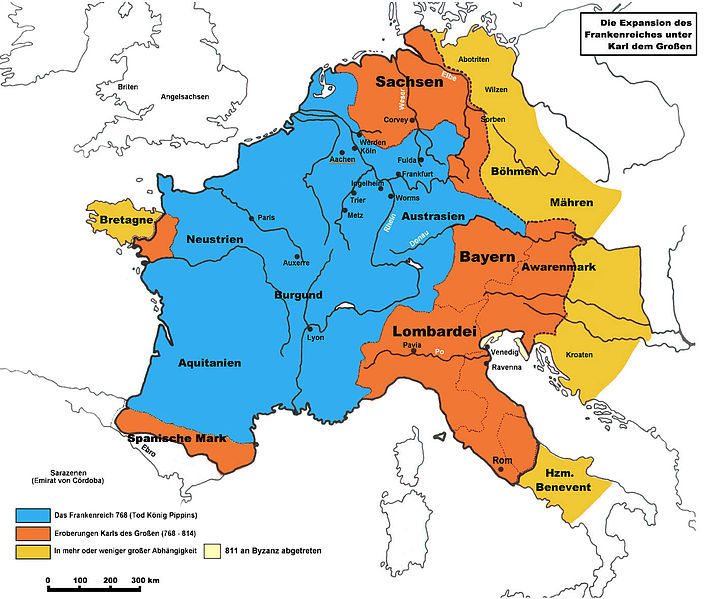
 Bild [redaktionell ergänzt]:
Bild [redaktionell ergänzt]:























