„Schlote, Schnaps und Schlempe”
Vom „geprant Wein“ zum Kornbranntwein Sendenhorster Brennereien im Wandel der Zeit
Die Ursprünge des „Kornbrennens“
Schon im frühen Mittelalter destillierte man Weinum hochprozentigen Alkohol zu gewinnen. Dieser „geprante Wein“ oder auch „Brantewein“ wurde zunächst fast aus- schließlich von Apothekern zur
Herstellung von „Artzeneyn“ und Duftwässern genutzt. Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis die Menschen die berauschende Wirkung des Alkohols für sich entdeckten. Bereits im 14. Jahrhundert sahen
sich die Obrigkeiten vieler Orte gezwungen, gegen den übermäßigen Genuss desselben vorzugehen Als man um1500 dazu überging, als Rohstoff das billigereGetreide zu verwenden, wurde der „ Brantewein zum
begehrten Getränk für alle Bevölkerungs- schichten. Der sog Destillierofen gehörte bald zum festen Inventar vieler Haushalte.
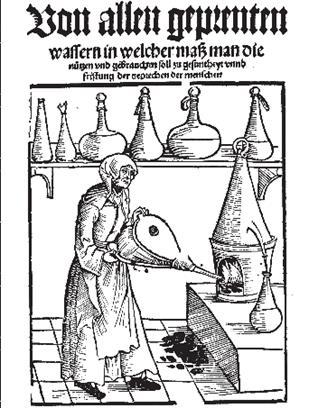 Abb.1: Hausfrau am Destillierofen (aus Schrick,
Michael, Doctor der Ertzney: Von allen geprennten Wassern. Augsburg 1480)
Abb.1: Hausfrau am Destillierofen (aus Schrick,
Michael, Doctor der Ertzney: Von allen geprennten Wassern. Augsburg 1480)
In der Festschrift „1884-1994. 110 Jahre Deutscher Kornbrennerverband“ (im folgen- den nur “Festschrift“) findet sich ein uraltes „Kornrezept“ aus dem Jahre 1576.
„Erstlich nim einen Kessel, geus ohngefehr funff Eymer Wasser darein und mache es heisz, doch dasz es nit siede. Darnach nimb einen halben Scheffel Saltz und thue es in einen groszen Kübel oder Tonne
und geus heiz Wasser darauff und rühre es umb, wie man sonst zum brauen das Maltz pflegetzu rühren. Nachmahls nimb auch einen halben Scheffel Weytzen oder Rocken. Rühre es auch wie das Maltz, dasz es
nit klö- terich bleibe, doch dasz das heisze Wasser, auff zwey Eymer ongefehr, im Kessel wol siedet. Alsdann geus es zum andern mahl ein, decke das Fasz fest zu und lasz es drei Stunden stehen.
Nachmahlen muszt du es stellen mit Bermen oder hefen, ehe du es aber stellest, muszt du es zuvor abkühlen mit einem Zuber Wasser oder mehr, bisz es wird dasz es zu stellen sey oder dine, als wann man
sonst hier stellet.
Von deme das in der Blasen bleibet, haben die Schweine gute Nahrung und wer- den damit bald fett gemestet, wann man inen ein wenig Treber oder Seye und Kleyen mit untermenget. Ist demnach beym
Branteweinbrennen allzeit ein doppelter Nutz und Frommen als nemlich, dasz man Brantewein bekompt und dar- neben seine Schweine damit ernehren und mesten kann.“
Auch wenn man davon ausgehen kann, dass die frühen Kornbrenner nur unzureichen- de Kenntnisse über den Gärungsprozess besaßen –die Wirkung der Hefe als Gärmittel war offenbar bereits bekannt. Nicht
klar ist allerdings die Funktion des Aufkochens eines „halben Scheffels“ Salzes(ein Scheffel „trockenes Schüttgut“ entsprach je nach Region immerhin einer Menge zwischen 45 und 64 Pfund) mit heißem
Wasser, und auch die Erwähnung des zur Verzuckerung der Maische nötigen Malzes nur in Verbindung mit dem Bierbrauen ist erstaunlich. Auf der anderen Seite war man sich aber bereits über den Nutzen
des beim Kornbrennen anfallenden Abfallproduktes „das in der Blasen bleibet“ – man nennt es heute Schlempe als hervorragendes Mastfutter für das Vieh im Klaren.
Abb.2: Hausfrau in der Brennstube (aus  Florinus,
Haus Vatter 1702)
Florinus,
Haus Vatter 1702)
Auch wenn, wie der abgebildete Holzschnitt aus dem Jahre 1702 (Abb. 2) zeigt, die Destilliergeräte weiter entwickelt und vergrößert wurden, müssen wir uns nach einem Bericht von 1931 in der oben
erwähnten Festschrift das Kornbrennen bis ins 19. Jahrhundert wohl als ein äußerst mühsamesUnterfangen vorstellen. Die Maische muss- te mit der Hand gerührt werden, die sog. Brennblase, die mit
direkter Feuerung betrie- ben wurde, verlangte ständige Aufsicht und es bedurfte mehrerer Destillationsgänge, um trinkbaren „Brantewein“ zu gewinnen. Das gängige Brennmaterial war Holz, das man mit
„schwerfälligen Ochsenkarren aus den Wäldern [holte]“.
Für das kleine Ackerbürgerstädtchen Sendenhorst finden sich erst im 18. Jahrhundert verlässliche Quellen, die die Herstellung von Branntwein belegen und die in dem Werk „Sendenhorst. Geschichte einer
Kleinstadt im Münsterland“ von Heinrich Petzmeyer beschrieben sind. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, im Jahre 1803 spricht der Kriegs- Commissar Kurlbaum in den „Acta Commissionis […] betreffend die
Lage und Gewerbe-Verhältniße der Städte und Wiegbolde des Erbfürstenthums Münster“ aller- dings nur von „drei Branntweinbrenner[n], welche nur allein im Winter und alsdann auch nur bei Tage und nicht
die Nacht hindurch brennen. Einer dieser Branntweinbrenner, der Colonus und Bürger Suergeist [Tergeist] wohnt außerhalb der Stadt nahe vor dem Tore.“ Und er erwähnt: „Der Branntwein bleibt
größtenteils in der Stadt und wird verzapfet, es wird aber auch wohl etwas nach Münster und andern umliegenden Städten verkauft, ingleichen an einige Zäpfer in den benachbarten Bauerschaften.“
Vom „Brennofen“ zur „Kolonne“ – technischer und wirt schaft- licher Fortschritt im 19. Jahrhundert
Bereits im Jahre 1817 hatte der Landwirt und Brenner Johann Heinrich Leberecht Pistorius (1777-1858) ein Destilliergerät mit indirekter Dampffeuerung erfunden, mit dem man in einem Arbeitsgang aus
Kartoffeln 60-80%igen Alkohol herstellen konnte. Der Kessel mit der dickflüssigenKartoffelmaische wurde nun nicht mehr mit direkter Unterfeuerung sondern mit Wasserdampf erhitzt, was eine Ersparnis
beim Brennmaterial bedeutete, wodurch aber auch das Ansetzen verhindert wurde. Die Folge war eine rasche Ausdehnung der Kartoffel- und Getreidebrennereien,wobei die letzteren durch die Einführung
einer höheren Maischraumsteuer stark benachteiligt waren.
In den Jahren 1824 und 1825 wendete sich das Blatt. Um die miserable Lage der Landwirtschaft zu verbessern, führte Preußen den Begriff der landwirtschaftlichen Brennereien ein. Sie galten unter der
Bedingung, nur Rohstoffe aus eigener Produktion zu verwenden, nicht mehr als Gewerbebetriebe und unterlagen so einem niedrigeren Steuersatz. Zudem wurden nun per Gesetz alle Beschränkungen des
Branntweinbrennens auf dem Lande beseitigt. Mit den verbesserten Rahmenbedingungen war die Grundlage für den Aufschwung der Kornbrennereien gelegt.
1831 gab es in Westfalen 1209 Kornbrennereien, wobei in Sendenhorst nur 4 Betriebe sicher nachgewiesen werden können. Die neue Technik der indirekten Dampffeuerung hielt hier allerdings erst in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Einzug. Noch im Jahre 1854 stellte der Sendenhorster Ackerwirth Theodor Wieler ein Concessions- gesuch, in dem ihm „eigentümlich gehörigen Wohnhause Nr. 189 an der
Weststraße hiesiger Stadt eine Branntweinbrennerei zu errichten“, in der „das Brennen […]mit direkter Heizung und nicht mittels Wasserdämpfe geschehen [soll]“.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist in Sendenhorst ein deutlicher zahlenmäßiger Anstieg der Brennereibetriebe zu verzeichnen. Im Öffentlichen Anzeiger des Amtsblattes wurde die beabsichtigte oder
bereits erfolgte Neuein- richtung etlicher Brennereien in Sendenhorst Stadt und Kirchspiel angekündigt (u.a. Colon Werring/Elmenhorst (1847), Gastwirth Wilhelm Böcker (1849), Hermann Böcker/Oststraße
(1854), Theodor Wieler/Weststraße (1854); Panning (1857), Kaufmann Heinrich Everke (1859), Ackerwirth Johann Vrede/Kirchspiel Rinkhöven (1860)).
Gleichzeitig oder nur wenige Jahre später wurden viele der bereits bestehenden Anlagen umgestellt auf Destilliergeräte mit indirekter Dampffeuerung, auf sog. Niederdruckkessel. Aus dem Öffentlichen
Anzeiger geht hervor, dass u.a. die Brennereien H. Brüning (1853), Hermann Werring/Südstraße (1856), Theodor Wieler/Weststraße (1857); Gast- wirth Anton Neuhaus/später Suermann (1858), Gastwirth
Christian Silling/Oststraße (1859), Theodor Böcker/Oststraße (1860) und Tergeist (1869) dazu gehörten.
Mit der Einführung der Dampfkessel, die unter Druck standen, wurden die Brennereien den Aufsichtsbehörden unterstellt. Vor allem das sog. Sicherheitsventil des Kessels musste regelmäßig gewartet und
auf seine Funktionsfähigkeit geprüft werden. In jedem Concessionsgesuch zur Errichtung einer Dampfkesselanlage ist deshalb auch eine Zeichnung dieses Geräteteils zu finden.
Durch die Aufsichtsbehörden wurden sog. Spezialakten oder auch Amtsakten angelegt, in denen alle Concessionsgesuche mit den zugehörigen Plänen, Bau- und – Betriebsgenehmigungen, Prüfungs- und
Abnahmeergebnissen sowie der amtliche Schriftverkehr gesammelt wurden. So ist es uns heute möglich, zumindest ab dem Zeitpunkt der Einrichtung einer Dampfkesselanlage die Entwicklung aller
Sendenhorster Brennereien im Stadtgebiet und im Kirchspiel nach zu erfolgen.
Bei der Dampfkesselanlage des Hermann Böcker zu Sendenhorst aus dem Jahre 1854 ist die Feuerung mit aufsitzendem Wasser bzw. Wasserdampf-Behälter zu erkennen, mit dem nun der Inhalt der Blase zum
Sieden gebracht wurde. Aus der Grundriss-Zeichnung des Gebäudes geht zudem hervor, dass die Brennerei Teil des Wohnhauses war.
Die Ausmaße der Anlagen waren um diese Zeit in der Regel nicht so groß, dass man separater Brennereigebäude bedurfte. So befand sich z.B. auch die Brennereianlage des Christian Silling in der
Oststraße in einem Raum neben der Schlafstube und mit direktem Zugang zur Küche.

Das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts wurde bestimmt durch den Aufschwung des Bergbaus und der Eisenindustrie im Ruhrgebiet. Damit verbunden war eine stetig steigende Nachfrage nach Kornbranntwein,
die bis zum Ersten Weltkrieg anhalten sollte.
Am 26.1.1884 schlossen sich die westdeutschen Kornbrenner zum Verein westdeut- scher Brennereien zusammen und einen Monat später fand die erste Generalversammlung des Kornbrennerverbandes statt. Ein
erster Versuch des Reichskanzlers Bismarck, ein Branntweinmonopol zu errichten, schlug fehl. Die nun in einem Verband zusammen agierenden Kornbrenner wehrten sich mit aller Macht dagegen, allen
Rohbrand an das Monopol zur Weiterverarbeitung abzuliefern, da ihnen damit die Möglichkeit des Trinkbranntweinverkaufs genommen worden wäre.
Bereits zu Beginn des Jahrhunderts hatte man – wie oben bereits erwähnt - die land- wirtschaftlichen Brennereien durch niedrige Steuersätze gefördert. Mit dem Inkrafttreten des
Reichsbrandweinsteuergesetzes im Jahre 1887 wurden noch einmal bis heute gültige Bedingungen für dielandwirtschaftlichen Brennereien festgelegt, die weiterhin steuerlich begünstigt werden
sollten:
Die Brennerei muss mit einem landwirtschaftlichen Betrieb verbunden sein. Als Rohstoffe sind nur Kartoffeln und Getreide zugelassen. Die Schlempe und der anfallende Viehdung müssen auf hofeigenen
Grund- stücken Verwendung finden oder aber es muss überwiegend Getreide aus eigener Produktion zum Brennen eingesetzt werden.
Technische Abbildungen | Bauzeichnungen | Pläne
Abb.3: Plan der Brennereianlage des Theodor Wieler mit Unterfeuerungskessel
(1854)
Abb.4: Sicherheitsventil der Kesselanlage des Heinrich Beumer (1856)
Abb.5: Anlage der Brennerei des Hermann Böcker, Oststraße (1854)
Abb.6: Brennapperat mit Kühler der Brennereianlage Chr. Silling, Oststraße (1859)
Abb.7: Neubau der Brennerei Bonse, Südstraße (1876) beantragte der Brennereibesitzer und erste Rendant der Sendenhorster Sparkasse, Bernhard Rötering, die Concession zum Betrieb eines liegenden,
„nicht explodie- renden Circlations-Wasserrohrkessels“ nach dem System „Root“.
Abb.8: Circulations-Wasserrohrkessel Brennerei Bernhard Rötering (1889)
Abb.9: Brennerei Edmund Panning mit stehendem Dampfkessel (1909)
Abb.11: Lageplan/Grundriss des Grundstücks Lainck-Vissing (1910)
Abb.12: Brennereianlage-Schema Josef Arens-Sommersell (1951)
Abb.13: Brennereianlage Josef Horstmann (1975)
Abb.14: Maische-Destilliergerät/Rohbrandkolonne Arens-Sommersell (1957)
Abb.15: Rektifiziergerät/Feinbrandkolonne Horstmann (1963)
Abb.16: Henzedämpfer Brennerei Werring (1918)
Die sog. Brennrechte wurden bei Kornbrennereien nach dem Düngebedarf des angeschlossenen
landwirtschaftlichen Betriebes festgelegt. Dabei gab es Höchstgrenzen, um angesichts der damals herrschenden Agrarkrise möglichst viele landwirtschaftliche Betriebe durch die Einrichtung einer
Brennerei besser zu stellen.
Die Einführung der Dampfkessel-Technik und die damit verbundene größere Brennkapazität, aber wohl auch diese besseren Rahmenbedingungen bewogen tatsäch- lich etliche Sendenhorster Landwirte bzw.
Brenner, im letzten Viertel des 19. Jahrhun- derts, eine landwirtschaftliche Brennereizu gründen bzw. die Kapazität der vorhande- nen Anlage zu vergrößern.
So errichtete z.B. der Landwirt und Posthalter Theodor Bonse 1876 ein großzügiges, unterkellertes Brennereigebäude, das mit einem Branntwein- und einem Maischkeller, einem sog. Kühlschiff zum
Herunterkühlen der verzuckerten Maische und einem Brennraum mit einfachem Dampf-Destillationsgerät mit Kühlfass ausgestattet war. Mit der Anlage einer sog. Locomobile erwarb „der Landwirt Theodor
Horstmann zu Kirchspiel Sendenhorst“ im Jahre 1885 einen beweglichen, leistungsfähigeren Dampfkessel, der nicht nur als Wärmequelle für die Brennerei, sondern auch zum Dreschen und Mahlen genutzt
werden konnte. Nur vier Jahre später, im Jahre 1889
Das 20. Jahrhundert – Aufschwung und Einbrüche
Die Entwicklung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges
Um die Jahrhundertwende wurden in vielen Sendenhorster Brennereien ähnlich lei- stungsfähige Dampfkessel unterschiedlicher Typen mit 6 bis 9 Atm Überdruck instal- liert (u.a. Arens gut Sommersell
1911/7 Atm; Everke 1902/8 Atm; Horstmann 1890/6 Atm; Panning 1912/ 7 Atm; Hesse/später Graute 1910/8 Atm).
Mit Ausnahme von Edmund Panning, der im Jahre 1909 noch innerhalb seines Wohnhauses an der Weststraße am Kirchplatz (heute Wiedehage) einen kleinen Bereich als Kesselhaus mit einem Platz sparenden
stehenden Kessel und einem nur 9 m hohen Blechkamin einrichtete, entschiedensich die Sendenhorster Brenner für liegende, autarke und fest eingebaute Dampfkessel, die ein stattliches Format aufwiesen.
Sie dienten zum einen für den Brennvorgang als Heizquelle; zum anderen aber wurde mit ihnen Druck zum Antrieb einer Dampfmaschine erzeugt, mit der wiederum über
Abb.10: Sendenhorst um 1950 aus südwestlicher 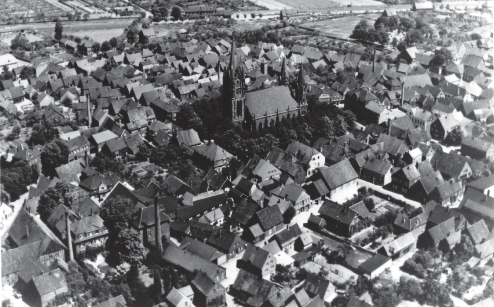 Richtung. Zu sehen sind die Schornsteine der Brennereien Rötering,
Graute, Jönsthövel, Everke (hinter Kirchturm), Panning, Lainck-Vissing, Oststraße und Silling, Oststraße
Richtung. Zu sehen sind die Schornsteine der Brennereien Rötering,
Graute, Jönsthövel, Everke (hinter Kirchturm), Panning, Lainck-Vissing, Oststraße und Silling, Oststraße
Transmissionsriemen Pumpen und andere Geräte in Bewegung gesetzt werden konn- ten. Für diese großen Kessel benötigte man eigene Kesselhäuser und hohe Schornsteine, die bis zur Stadtsanierung ab den
70er Jahren des 20. Jahrhunderts das Stadtbild prägten.
Mit der Einführung dieser neuen Generation von Dampfkesseln, die in den folgenden Jahrzehnten immer wieder gegen größere und leistungsfähigere Apparate ausgetauscht werden sollten, änderte sich auch
die gesamte technische Ausstattung der Kornbren- nereien. Die Zeit der kleinformatigen „Alleskönner“, die nur über eine geringe Brennkapazität verfügten und in einem Raum untergebracht werden
konnten, war jetzt endgültig vorbei. Die Brennereieinrichtungen wurden zu räumlich und technisch höchst anspruchsvollen Anlagen. Aufgrund ihrer Ausmaße und der Vielfalt der Gerätschaften entstanden
nun oft mehrstöckige Brennereigebäude, die jedoch häufig noch immer in direkter Verbindung mit dem Wohnhaus des Brenners standen.
Abb. 11 zeigt den im Ortszentrum gelegenen Betrieb Lainck-Vissing im Jahre 1910, der mit dem Wohngebäude, der Brennerei, dem Hofraum, zahlreichen Ställen und anderen Wirtschaftsgebäuden das enge
Zusammenspiel zwischen Landwirtschaft und Brennereibetrieb verkörpert. Deutlich wird aber auch, wie eng die Bebauung im Stadtkern war und wie gering die Möglichkeiten zur Erweiterung des
Betriebes.
Die Inneneinrichtungen der vergrößerten Brennereibetriebe bestanden und bestehen noch immer aus einem autarken Dampfkessel und einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte und Behälter, die – verbunden
durch ein kompliziertes Rohrsystem - für ein- zelne spezifische Aufgabeninnerhalb des Brennvorgangs zuständig sind. Diese moder- nen Brennereianlagen sind leistungsfähiger und bedienungsfreundlicher
als die einfa- chen Geräte früherer Zeiten. Und dennoch: Das Prinzip des Kornbrennens hat sich seit den Anfängen kaum geändert.
Schritt für Schritt vom Korn zum „Korn“
1, Im Vormaischbottich (oder Henzedämpfer) wird gemahlenes Getreide mit Wasser vermischt (eingemaischt) und aufgekocht. Es entsteht ein Brei, die sog. Maische.
2. Ihr werden Gerstenmalz oder technische Enzyme zugesetzt, wodurch sich die Getreidestärke in Zucker umwandelt.
3. Im sog. Gärbottich wird der verzuckerten, herunter gekühlten Maische Hefe zugegeben, wodurch sich der Zucker in 72 Stunden bei einer Temperatur von 28-35 Grad in Alkohol und Kohlensäure
umwandelt.
4. Diese nun vergorene Maische wird heute in der sog. Rohbrandkolonne auf 104 Grad erhitzt bzw. zum Sieden gebracht.
5. Da der Siedepunkt des Alkohols (78,3 Grad Celsius) niedriger liegt als der der anderen Maischebestandteile, entweicht der Alkohol in Form von Dampf aus der Maische zur Spitze der Kolonne (früher
Brennblase).
6. Dort wird er aufgefangen und über ein Rohr in den sog. Kühler (früher Kühlfass) geleitet.
7. Durch die Abkühlung verflüssigt sich der Alkoholdampf; der sog. Rohbrand wird in einem Gefäß aufgefangen. Diesen Vorgang nennt man die erste Destillation.
8. In der Rohbrandkolonne (früher Brennblase) bleibt die entgeistete Maische zurück, die sog. Schlempe. Sie wird kontinuierlich abgepumpt und findet als Mastfutter für Tiere Verwendung.
9. Um trinkfertigen Kornbranntwein zu gewinnen wird der Rohbrand in einem zweiten Destillationsvorgang in der sog. Feinbrandkolonne von allen Unreinheiten und unerwünschten Geschmacks- und
Geruchsstoffen befreit. Danach wird der hochprozentige Feinbrand durch Zugabe von enthärteten (aufbereiteten) Wasser auf den gewünschten Alkoholgehalt gebracht.
Für jeden der beschriebenen Herstellungsschritte wurde ein eigenständiges Gerät konzipiert, das im Zusammenspiel mit den anderen eine weit höhere Brennkapazität ermöglicht, als das ehemals der Fall
war. Ein großer Unterschied zu den früheren Anlagen besteht auch darin, dass nun nicht mehr eine Brennblase sondern separate hohe sog. Kolonnen zur Herstellung des Rohbrandes als auch des Feinbrandes
dienen.
Ein weiteres Gerät soll hier noch erwähnt werden, das zur Erleichterung des Aufbereitens des Rohstoffes
„Getreide“ entwickelt wurde, heute aber aufgrund der verbesserten Möglichkeiten, das Getreide zu mahlen, kaum mehr benötigt wird - der rein konische oder zylindrisch-konische sog. Henzedämpfer
(vgl.Abb.16).
In Dr. Machers Leitfaden der Kornbrennerei-Praxis wird die Funktionsweise dieses Gerätes erklärt: Danach wird das Rohmaterial mittels Einwirkung von Hochdruck aufgeschlossen bzw. in einen erweichten
Zustand überführt. Das gar gekochte Dämpfgut wird bei dem auf das Dämpfen folgenden Ausblasen zu einem feinen Brei zerstäubt,der dann in Mischung mit Wasser + Malz die Maische ergibt.Beim Ausblasen
verbreitet sich ein strenger Maische-Geruch, der noch heute in der Erinnerung älterer Sendenhorster Bürger präsent ist. Welche Auswirkungen der Betrieb der Brennereien im eng bebauten Stadtkern haben
konnten, das wird aus einem Beschwerdeschreiben des Apothekers Pottmeyer (heute Adler-Apotheke) vom 26. November 1927 an den Beckumer Landrath Fenner von Fenneberg deutlich, das sich im Original in
der Amtsakte der Brennerei Panning im Sendenhorster Stadtarchiv befindet. Darin heißt es: “Durch fortwährende Änderungen und Neuanlagen der landwirtschaftlichen Brennerei meines Nachbars, Edmund
Panning hierselbst, wird mein Wohnhaus, in dem sich die Apotheke befindet, derartig in Mitleidenschaft gezogen, dass es unmöglich ist, meinen Apothekerbetrieb in vorschriftsmäßigem Zustand zu
erhalten. Sowohl das Inventar und die Vorräte in der Apotheke sowie auch meine Privatwohnung und Einrichtungen werden durch den fortwährenden Wasserdampf und durch Ablassen des heißen Wassers derart
beschädigt, dass ständige Reparaturen und Neuanschaffung von Apothekerwaren notwendig sind. Auch ist der Schornstein viel zu niedrig, um den Rauch in höhere Luftschichten abzulassen.
Durch die Anlage eines Henzedämpfers wird ein derartiger Geruch verbreitet, dass ein Aufenthalt in meinem Hause fast unmöglich ist. Ein Öffnen der Fenster ist ausgeschlossen und wird dadurch die
Feuchtigkeit noch vergrößert. Da die Brennerei in eine Dampfbrennerei umgeändert ist, erscheint mir die ganze Anlage nicht den Forderungen zu entsprechen, die polizeilicher Seits für eine
geschlossene Ortschaft verlangt werden. Ich ersuche höflich, meine Beschwerde einer gefälligen Prüfung zu unterziehen”.
Ergebenst Gez. H. Pottmeyer Apotheker
Nach Prüfung der Gegebenheiten meldete Bürgermeister Austrup an den Landrat Folgendes: “Die Angaben des Beschwerdeführers entsprechen zum größten Teil den Tatsachen. Die heißen Abwässer der Brennerei
fließen durch die gemeinschaftliche Gasse und die Straßenrinne, was nicht zulässig ist. Panning will demnächst die Abwässer unteridisch ableiten. Die Dampfbrennerei besteht seit 7 Jahren. Der
Schornstein hat eine Höhe von ca. 22 m. Bei tiefem Wolkengang schlägt der Rauch zur Erde. Der Henzedämpfer liegt im Obergeschoss der Brennerei und wird morgens von 6 bis 8 Uhr genutzt. Er verursacht
starkes Geräusch und üblen Geruch. Eine technische Prüfung durch das Gewerbeaufsichtsamt bzw. durch das Hochbauamt wäre hier angebracht”.
Die Beschwerdegründe wurden also anerkannt und der Brennereibesitzer Panning aufgefordert, die Mängel zu beseitigen.Allerdings fügt der Bürgermeister Austrup hinzu:
“Die Angelegenheit kann erst nach Beendigung der Brennperiode erledigt werden, da Panning sonst den ganzen Betrieb stilllegen muss. Pottmeyer erklärt sich damit einverstanden.“
Im Rückblick erscheint das 20. Jahrhundert für die Sendenhorster Kornbrennereien zum einen durch wirtschaftliche Aufschwungphasen, zum anderen aber durch schwere Einbrüche wie z.B. die beiden
Weltkriege geprägt.
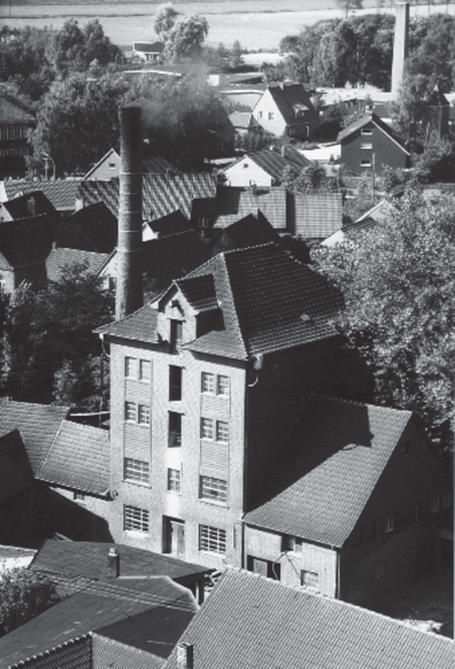 Abb.17: Neues Brennereigebäude Rötering (1934/35)
Abb.17: Neues Brennereigebäude Rötering (1934/35)
Die sich daraus ergebenden veränderten Rahmenbedingungen zwangen manchen Brenner zum Umdenken und Umstrukturieren oder sogar zur Aufgabe des Betriebes. Im Laufe des Ersten Weltkrieges wurden die
meisten Kornbrennereien mit einem Brennverbot belegt, das erst 8 Jahre später – im Jahre 1924 – aufgehoben wurde. In diesen langen Jahren des Stillstandes ging der Kornbranntweinmarkt weitgehend
verloren; die Bevölkerung war – so in der Festschrift – „nicht mehr an den Korngenuß gewöhnt“.
Ein Jahr nach Kriegsende, am 1. Oktober 1919, brach eine neue Ära in der Geschichte der Kornbrennereien an. Mit dem Ziel, höhere Steuereinnahmen zu erzielen, schuf die Regierung gegen den Willen der
Kornbrenner nun doch das Branntweinmonopol. Es sah die Abgabe des Rohbrandes an die Monopolverwaltung vor, die jetzt die Herstellung des Trinkbranntweins übernehmen sollte.Von diesem Zeitpunkt an
überließen die Kornbrenner den Grossteil ihres Rohbrandes zu einem festgelegten Übernahmepreis der Monopolverwaltung. Im Gegensatz zu der Zeit davor, als die gesamte Produktionsmenge selbst
vertrieben wurde, verarbeitete man nun nur noch eine kleinere Menge Rohbrand zu trinkfertigem Korn, um diesen in Eigenregie zu vermarkten.
1922 gründete man die „Einkaufsgesellschaft Deutscher Getreidebrennereien GmbH“ (EDG) – eine Institution, die sich mit der Beschaffung der Rohstoffe und Betriebsmittel für das Brennereigewerbe, ihrer
Lagerung und ihres Transports befasste. 1923 und 1930 folgten zwei weitere Selbsthilfeorganisationen – die Amylo-Deutsche Getreideimport-Bank AG“ zur Finanzierung der Rohstoffeinkäufe der EDG, und
die Deutsche Kornbranntwein-Verwertungsstelle GmbH (DKV) mit Sitz in Münster. Ihre Aufgabe sollte es u.a. sein, den Kornbranntwein, den die Brenner nicht selbst verwerteten, im Auftrag der
Monopolverwaltung zu übernehmen, um ein Überangebot auf dem Markt und den damit verbundenen Preisverfall zu verhindern.
Zumindest in Sendenhorst hat es den Anschein, dass sich einige Kornbrennereien in diesen Jahren nach der Einführung des Branntweinmonopols, mit der die Abgabe des Rohdestillats gegen ein festes
Übernahmegeld verbunden war, durchaus erholten. So wurden hier gerade in den 20er Jahren in zahlreichen Sendenhorster Betrieben die vorhandenen Dampfkessel durch größere und leistungsfähigere Geräte
ersetzt, Kesselhäuser oder neue Brennereigebäude gebaut (u.a. Panning (1922) , Hesse/später Graute (1923), Jönsthövel (1923), Bonse (1925),Arens-Sommersell (1928)). Mit dem Ausbau der Brennereien
ging oft auch die Vergrößerung der Stallungen einher, da mit den verbesserten Brenngeräten mehr Schlempe für die Tiere anfiel. Zudem errichteten einige Brennereibesitzer repräsentative Villen, die
vom Wohlstand ihrer Bewohner kündeten (u.a. Rötering 1922/23, Arens-Sommersell 1923, Werring, Elmenhorst 1923.
Doch in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg verschlechterte sich die Lage zusehends. 1933 erschien in der Brennerei-Zeitung ein Artikel mit dem Titel „Kornbrennerei in Not“. Absatznot bei gleich
bleibenden Unkosten, Preisschleuderei sowie die ausgedehnte Schwarzbrennerei wurden als Gründe für die prekäre Lage der Kornbrennereien angegeben. In der besagten Festschrift werden die schwierigen
Bedingungen unter der National sozialistischen Regierung beschrieben. Bereits 1935 verlor der Kornbrennerverein seine Unabhängigkeit. Im Rahmen des organisatorischen Neuaufbaus der deutschen
Wirtschaft wurde er in die sog. Fachgruppe Kornbrennereien der Wirtschaftsgruppe Spiritusindustrie eingegliedert. Bis 1945 war man nun Teil des Reichsnährstandes.
Ein Jahr darauf wurde ein Brennverbot für die Brotgetreidesorten Roggen und Weizen erlassen, da man eine „Nationalreserve“ anlegen wollte.Auch wenn dieses Brennverbot immer wieder einmal gelockert
wurde und teilweise auch Gerste und andere Rohstoffe zur Verarbeitung zugelassen wurden - im Grunde waren mit Ausnahme derBrennerei Everke,die den Betrieb aufrecht erhalten durfte, in den Kriegsjahren und zum Teil noch bis 1947/48 alle
Sendenhorster Brenner davon betroffen. In den noch vorhandenen Familienarchiven der ehemaligen bzw. noch aktiven Kornbrenner finden sich zahlreiche Schreiben an die „Fachgruppe“ und nach Kriegsende
an die sog. Militärregierung, in denen man geradezu verzweifelt um die Erlaubnis zur Wiederaufnahme der Brenntätigkeit bittet
im Grunde waren mit Ausnahme derBrennerei Everke,die den Betrieb aufrecht erhalten durfte, in den Kriegsjahren und zum Teil noch bis 1947/48 alle
Sendenhorster Brenner davon betroffen. In den noch vorhandenen Familienarchiven der ehemaligen bzw. noch aktiven Kornbrenner finden sich zahlreiche Schreiben an die „Fachgruppe“ und nach Kriegsende
an die sog. Militärregierung, in denen man geradezu verzweifelt um die Erlaubnis zur Wiederaufnahme der Brenntätigkeit bittet
Abb.18: Schreiben an verschiedene Brennereien betr. „Transfer of Stocks“ an Everke (12.1.1946)
 Abb.19: Schreiben an H. Brüning betr. „Abverfügung“ von Brenngetreide und Malz an J.H. Everke (29.12.1945)
Abb.19: Schreiben an H. Brüning betr. „Abverfügung“ von Brenngetreide und Malz an J.H. Everke (29.12.1945)
Schnaps ist Schnaps … (Dieter Obermeyer)
„Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“ - Wenn man einmal den Alkohol aus diesem bekannten Sprichwort herausfiltert, kann man ohne Schwierigkeiten durchaus den Übergang zum Sendenhorst nach der
Jahrhundertwende und bis in die Zeit nach dem 2.Weltkrieg hinein finden, Es gab nämlich in dem kleinen Ort zeitweilig bis zu dreizehn Schnapsbrennereien, allerdings recht unterschiedlicher Größe und
Bedeutung. Immerhin war es in der Vergangenheit etlichen Sendenhorster Bürgern nicht nur gelungen, die für die Herstellung von Schnaps erforderliche Anlage zu erstellen, sondern dazu auch die
wichtige Lizenz, das sog. Brennrecht zu erwerben. Gewiss konnte man die recht gute wirtschaftliche Situation einiger Sendenhorster Brennereibesitzer – man nannte sie kurz Brenner – nicht unbedingt
vergleichen mit dem Besitzstand mancher Weingutbesitzer an Rhein und Mosel, doch zeigten Haus und Hof einiger von ihnen doch recht deutlich einen für damalige Verhältnisse sehr soliden Wohlstand, der
sich zum Teil erheblich unterschied vom Status der meisten Mitbewohner.
Der Grundstoff für die Herstellung von Schnaps, Weizen oder Korn, wuchs im Umfeld, oft auf eigenen Feldern der Brenner. Dies mag also durchaus früher einmal Auslöser gewesen sein für die Idee,
geerntetes Getreide nicht nur für die herkömmliche Art der Herstellung von Mehl und Brot zu verwenden, sondern eine Art von „flüssigem Brot“ herzustellen, die wesentlich mehr Profit versprach, zumal
man ursprünglich sicher sein konnte, dass die im Umkreis recht zahlreiche Gastronomie für den mit 32 und 38 Prozent Alkohol hergestellten Korn und Doppelkorn reichlich Verwendungsmöglichkeiten hatte.
So soll dem Vernehmen nach vor dem Ersten Weltkrieg ein Gläschen Schnaps in der Kneipe noch für 5 Pfennige zu erhalten gewesen sein. Dass Herstellernutzen und Wiederverkäuferspanne dennoch einen
akzeptablen Gewinn sicher stellten, ist neben dem damals im Vergleich mit heute nicht nur völlig unterschiedlichen Geldwertverhältnissen zuzuschreiben, sondern auch einem recht bedeutenden Konsum von
Korn und Doppelkorn in den Gasthäusern ebenso wie bei tausend privaten Gelegenheiten, ganz „hennig eben mal einen einzuschütten“.
Hier erinnere ich mich deutlich an ein Erlebnis, das ich in einer Gaststätte beobachtet habe. Gast, das schon geleerte Schnapsgläschen dem Wirt hinschiebend:„Franz, do mi no een!“ Franz darauf mit
der Flasche hantierend und mit gluckgluck das Gläschen wieder füllend: „Dann sehr zum Wohle!“ Gast, nachdem er den Schnaps in einem einzigen Schluck hinuntergeschluckt hatte, sich mehrfach
schüttelnd: „Käärl, wat schmeckt dat tügs..“ Sich immer noch schüttelnd und das Gläschen erneut hinhaltend:“ Denn do mi men no een!“
Ich denke, dass die Beschreibung dieser Szene, die sich so oder ähnlich häufig wiederholte, von den Usancen jener Zeit ein lebendiges Bild vermitteln kann. Schnaps hatte damals, im Gegensatz zu
heute, im ländlichen Münsterland so gut wie keine Konkurrenz in Gestalt von Cognac, Aperitif und Whisky, war insofern wirklich eine Art „Alleinunterhalter“.
Ist nun schon von Schnapsbrennen und Destillieren die Rede, dann muss hier auch ein Produkt genannt werden, das beim Abbrennen von Getreide im alkoholischen Gärprozeß nicht nur durch seinen typischen
Duft Bedeutung erlangt, sondern auch dadurch, dass es sich vorzüglich zum Füttern von Rindvieh eignet. Die Rede ist von der Schlempe, die gewissermaßen ganz nebenbei den Brennereien zufloss. So war
es nicht verwunderlich, dass je nach Größe und Bedeutung der Unternehmen in deren Kuhställen und auf den Wiesen Kühe und Kälber mit diesem Produkt gefüttert werden konnten.
Ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht, was mir ein Brennereibesitzer einmal erzählte. Er meinte nämlich, dass je nach Qualitätsbeschaffenheit der Schlempe, seine Kühe deutliche Symptome
gezeigt hätten, die denen eines leicht betrunkenen Menschen durchaus vergleichbar gewesen wären. Möglich wär’s….
Schmiede und Brennereien im Stadtkern (Bernhard Münstermann)
Unsere Schmiede hatte vor allem in den Jahren 1970 – 1979 (dann wurde der Betrieb ins Industriegebiet verlagert und die meisten Brennereien waren im Rahmen der Stadtsanierung bereits aus der
Innenstadt verschwunden) viel in den Brennereien zu tun.
 Abb.20: Schmiede Münstermann (heute Buschkötter)
Abb.20: Schmiede Münstermann (heute Buschkötter)
 Abb.21: Reklame Schmiede Münstermann
Abb.21: Reklame Schmiede Münstermann
In den Jahren davor arbeitete man in den Betrieben noch viel mit Kupfergeräten, die von speziellen
Kupferschmieden und Spezialmonteuren betreut werden mussten. Erst mit der Umstellung auf Eisen und Stahl beauftragten die Brenner auch örtliche Handwerker und Schmiede mit allen anfallenden Arbeiten.
So mussten die Dampfmaschinen, die Rohrleitungen und Ventile regelmäßig gewartet, repariert oder ausgewechselt werden.
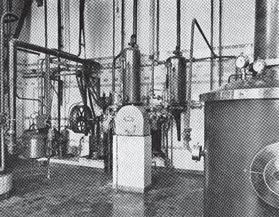
Abb. 22 Innenraum Brennerei Rötering
ch erinnere mich, dass so gut wie alle Sendenhorster Brennereien mit gebraucht gekauften Dampfkesseln arbeiteten, die sich wenig voneinander unterschieden. Einige Kessel hatten innen ein gewelltes
sog. Flammrohr. Es gab aber auch Röhrenkessel, die eine größere Heizfläche hatten und deshalb schneller Dampf produzieren konnten. Sie waren aber empfindlicher und mussten öfter gereinigt werden.
Unsere Schmiede lag genau gegenüber Graute. Das Grautesche Wohnhaus mit Tenne und Brennerei an der Ecke Weststraße/Schleiten ist heute im Besitz der Familie Kleinhans. Auf dem Parkplatz, der sich
jetzt hinter dem Haus befindet, standen ein Speicher und ein Haus der Familie Bücker.
 Abb.23: Haus Münstermann an der Weststraße; im Hintergrund die Einfahrt von Graute
Abb.23: Haus Münstermann an der Weststraße; im Hintergrund die Einfahrt von Graute
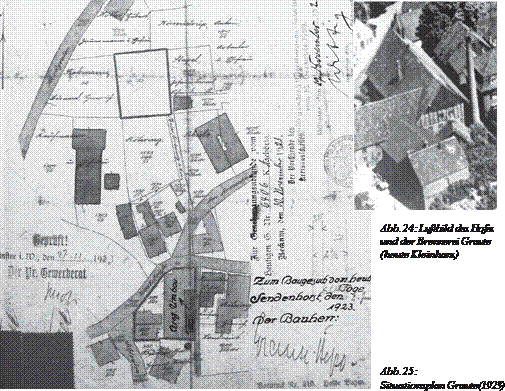 Abb.24: Luftbild des Hofes und der Brennerei Graute (heute Kleinhans)
Abb.24: Luftbild des Hofes und der Brennerei Graute (heute Kleinhans)
Abb.25: Situationsplan Graute (1923)
(ein Bild)
Heute sind im Wohnhaus Arztpraxen untergebracht. Genau an dieser Stelle befand sich die Tenne und davor die Hofeinfahrt, die durch eine Mauer mit Spitzbogentor von der Straße abgeschirmt war. Die
Diele des Hauses war mit Bruchsteinplaster gepflastert. Von dort aus konnte man direkt in die Brennerei gehen, die zur Liebesgasse hin lag. Auf der Tenne standen rechts die Schweine und links ca. 22
Kühe. Einen Misthaufen hatte man nicht – das hätte Frau Graute nichtgeduldet. Stattdessen stand werktags und sonntags permanent eine Mistkarre auf dem Schleiten.Als sich die Anlieger darüber
beschwerten, wurde die Karre zumindest am Sonntag auf die Tenne gefahren. Das Wohnhaus, in das man über den Eingang an der Weststraße gelangte, hat sich wenig verändert. Die Mauer und die Stallungen
wurden dagegen restlos abgebrochen.
Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, dann muss ich sagen, die Brennereien brachten viel Leben in die Stadt. Den ganzen Tag über liefen die Dampfmaschinen bzw. Dampfkessel. Die fauchten wie
eine Lokomotive, wenn man eine Brennerei betrat. Das war eine herrliche Sache! Aber auch wenn man auf der Straße war, dann war da der Dampf und der Geruch der Schlempe, die durch das ganze Städtchen
zogen und man hörte das Vieh muhen und das Rasseln der Ketten. Zudem lief heißes Wasser aus den Brennereien in den Rinnstein. Bei Everke holten sich die Nachbarn das Wasser zum Putzen und Baden; bei
Sommersells bedienten sich die Familien Decker, Brüggemann und die Schule. Im Gegensatz zu den kleineren Ackerbürgern hatten die Brennereibetriebe viele Tiere, um die Schlempe zu verfüttern. Die
Brenner waren deshalb ständig mit dem Fahren von Mist und Jauche in Fässern beschäftigt. Und an Sommertagen wurden die Tiere quer durch die Stadt auf die Weide getrieben. Die hatten ja alle auch
Milchkühe.
Im Krieg erzeugten die Brenner die weniger wertvolle Zuckerschnitzelschlempe, die mit dem damals noch hölzernen Jauchefass auf den Wiesen verteilt wurde. Dort wo heute der Uhrenladen Mütherig ist,
gab es einmal einen schweren Zwischenfall: Ein Mann fuhr mit zwei Pferden und einem Jauchefass voller heißer Schlempe (80-100 Grad) in Richtung Bahnhof, als sich plötzlich das Endstück des Fasses
löste. Die heiße Schlempe ergoss sich über die Hacken der Pferde auf die Straße. Die Pferde gingen durch und konnten erst bei dem Bauer Tüte gestoppt werden. Mit Besen und Eimern musste die Schlempe
von der Straße entfernt werden. Auf der Schulstraße gab es ja damals noch keine Kanalisation. So lief z.B. das warme Wasser aus der Brennerei Sommersell zwischen dem Wohnhaus und demNachbarn Meyer
auf die Weststraße und von dort bis zum Haus Schrei, wo der Abwasserkanal erst anfing.
 Abb.26: Weststraße mit altem Sommersellschen Haus, rechts Haus Rötering
Abb.26: Weststraße mit altem Sommersellschen Haus, rechts Haus Rötering
Jeden Monat musste das Brennmaterial – es handelte sich hier vor allem um Roggen angefahren werden. Zu der Zeit kauften die Brennereien das Getreide noch nicht bei der Genossenschaft sondern bei der
EDG, die dann einen Waggon nach Sendenhorst schickte, der z.B. unter drei Brennereien aufgeteilt wurde (im Westen waren das Graute, Arens-Sommersell und Rötering).Vielleicht dreimal an einem Tag
wurde die gesackte Ware mit großen Kastenwägen, die mit Pferden gezogen wurden, vom Bahnhof zu den Brennereien in der Innenstadt gebracht. Stadteinwärts ging es über die Weststraße, stadtauswärts
über die Schulstraße.
Ab den 50er Jahren, als der Verkehr zunahm und man das Getreide immer mehr mit Treckern und Hängern anlieferte, stand am Eingang des Grauteschen Wohnhauses die Haushälterin - die „Tetta“ (Grete) -
mit einer roten Fahne, um den Verkehr zu warnen. Sie stand da vielleicht eine Dreiviertelstunde, eben so lange, bis alle Zweizentnersäcke über den Lastenkran nach oben auf den Speicherboden gezogen
waren (heute Ausstellungs- und Konzertraum der Familie Kleinhans).
 Abb.27: Kastenwagen vor der Gaststätte und Brennerei
Jönsthövel
Abb.27: Kastenwagen vor der Gaststätte und Brennerei
Jönsthövel
Ich erinnere mich, dass bei Grautens immer eine kleine Karaffe mit Schnaps und ein Pintchen standen. Abends bekamen alle Mitarbeiter – auch die Zwangsarbeiter (wäh- rend des Krieges waren ein
Holländer, ein Pole und ein Russe dort beschäftigt) – ein Schnäpschen. Einmal passierte etwas, womit niemand gerechnet hatte. Herr Eilermann (der Vater von Heiti Eilermann) hatte beim
Kalkstickstoffstreuen mitgeholfen und offensichtlich dieVerarbeitungs-Vorschriften nicht beachtet.Vor dem Essen gab es dann das bewussteSchnäpschen, was in Verbindung mit den Kalkstickstoffresten zu
schwe- ren inneren Verbrennungen führte.
„Westen-Silling“
In unserer Nachbarschaft gab es noch „Westen-Silling“. Das war eine relativ kleine Brennerei schräg gegenüber dem Krankenhaus am Westtor. Bis in die 50er Jahre arbei- tete man dort nur mit einem
Niederdruckkessel, der aus dem Krankenhaus stammte und dasAussehen einer schwarzen Blechkiste hatte, um die man einige Steine gesetzt hatte. Frau Silling betrieb dort auch ein Textilgeschäft. Ihr
Mann beschäftigte sich vorrangig mit dem Kornbrennen. Er stellte schon sehr früh Liköre her, die er auch selbst vermarktete. Das war zu einer Zeit, als alle anderen sich noch ausschließlich mit Korn
und Wacholder beschäftigten.
K ein Angehöriger dieser Brennereifamilie Silling am Westtor lebt heutenoch in Sendenhorst. Das einzige Relikt, das noch an sie erinnert, ist ein
wertvoller, alter Grabstein, der nach einer längeren Einlager
ein Angehöriger dieser Brennereifamilie Silling am Westtor lebt heutenoch in Sendenhorst. Das einzige Relikt, das noch an sie erinnert, ist ein
wertvoller, alter Grabstein, der nach einer längeren Einlager ungszeit erst vor kurzem auf dem Sendenhorster Friedhof als historisches
Zeugnis wieder aufgestellt wurde.
ungszeit erst vor kurzem auf dem Sendenhorster Friedhof als historisches
Zeugnis wieder aufgestellt wurde.
Abb.28: Ehemaliges Haus Silling an der Weststraße (Westen-Silling)
Abb.29: Grabstein des Brennerei-besitzers Silling
Der Wiederbeginn nach 1945
In den ersten Jahren nach dem Krieg standen die Sendenhorster Brennereien unter der Aufsicht der britischen Militärregierung. Kontakte zu den Alliierten kamen zunächst durch Einquartierungen
zustande, wofür man bevorzugt die stattlichen Wohnhäuser der wohlhabenderen Brennerfamilien heranzog. Gewöhnlich wurde den Besitzerfamilien in dieser Zeit in einem Raum oder in Nebengebäuden wie den
stillgelegten Brennereien Wohnraum zugewiesen. Eine Aufstellung der Belegung des Röteringschen Wohnhauses machtexemplarisch deutlich, welche Belastungen manche Brennerfamilien (ähnlich u.a. Everke,
Jönsthövel) in dieser Zeit ertragen mussten, ganz abgesehen von den Schäden an Häusern, Mobiliar und anderen Wertsachen und durch Verlust.
 Abb.30: Fragebogen für die Erstattung von Mietausfällen für durch die Militärregierung besetzten Wohnraum im Haus Roetering in der Weststraße
Abb.30: Fragebogen für die Erstattung von Mietausfällen für durch die Militärregierung besetzten Wohnraum im Haus Roetering in der Weststraße
Für den Betrieb der Brennereien wurden erst mit dem Gesetz über die Errichtung der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, das rückwirkend zum 1.10.1950 in Kraft gesetzt wurde, klare
Rahmenbedingungen geschaffen. Sie knüpften in Bezug auf die Abgabe des Rohbrandes an die DKV bzw. Monopolverwaltung gegen feste Übernah- mepreise an der Vorkriegszeit an. Im gleichen Jahr gründete
man anstelle des früheren Zentralverbandes den Bundesver- band deutscher Kornbrenner, der sich nun auf Bundesebene für die Belange der Kornbrennereien einsetzt. Laut Festschrift war es von Anfang an
ein großes Anliegen, den volkswirtschaft- lichen Nutzen der Kornbrennereien zu verdeutli- chen, aber auch „bei der breiten Masse des arbeiten- den Volkes“ den deutschen Kornbranntwein als
„natürliches und notwendiges Genuss-mittel“ bekannt zu machen. Es ist deshalb nicht verwunder- lich, dass in den folgenden Jahren große Werbeaktio- nen für den deutschen Korn durchgeführt wurden. Die
Vorliebe für Süßes nach den lan- gen Jahren der kriegsbedingten Ent- haltsamkeit, führte in den 50er Jahren in den Sendenhorster Be- trieben zur Herstellung einer Viel- zahl unterschiedlichster
Liköre auf Kornbasis, die offenbar reißenden Absatz fanden und die wirtschaftli- che Erholung der Kornbren-nereien förderten. Aber auch andere neue Entwicklungen ergaben sich. So führten z.B.
freundschaftliche Kon- takte zu jüdischen Geschäftsleuten, die während der nationalsozialisti- schen Zeit in die USA emigriert waren, dazu, dass die Brennerei Everke mit großem Erfolg hauseige- nen
Korn, Liköre und sogar ein Whisky-Imitat von Sendenhorst nach Übersee exportierte.
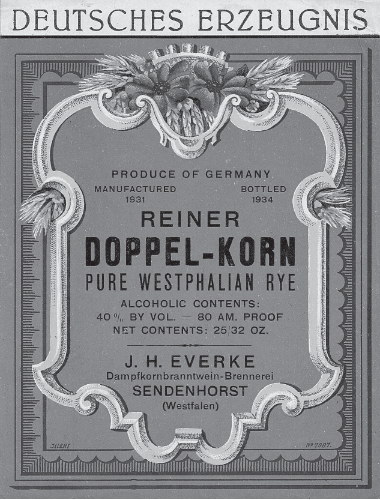 Abb.31: Werbung für den deutschen Korn in den 50er Jahren
Abb.31: Werbung für den deutschen Korn in den 50er Jahren
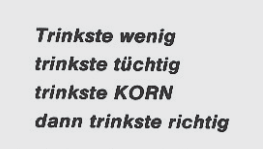 Abb.32: Etikett Everke für den Export in die USA
Abb.32: Etikett Everke für den Export in die USA
Für die Sendenhorster Brennereien gilt für den Zeitraum 1950 bis zur Stadtsanierung in den 70er Jahren, dass sich die Anzahl der Betriebe im Vergleich zur Vorkriegszeit verringerte, dass diese aber
durch Aufkauf von Brennrecht und durch Neu- und Nachveranlagungen gewaltig vergrößert wurden. So verfügte z.B. die heute noch aktive Brennerei Arens-Sommersell bis 1949 über ein Brennrecht von rund
259Hektoliter. Infolge von Neuveranlagungen in den Jahren 1962 und 1970 und mehreren Zukäufen beträgt es heute 1501 Hektoliter. Noch eindrucksvoller stellt sich die Entwicklung der Sendenhorster
Brennerei Horstmann dar, die heute als einzige noch selbst hauseigenen Korn produziert und vermarktet und deren Brennrecht sich von 260 Hektoliter vor dem Krieg auf nunmehr 2525 Hektoliter
vergrößerte. Mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahre 1957 wurde eine neue Entwicklung eingeläutet. Bald darauf setzte man die Zölle zwischen den Mitgliedstaaten
schrittweise herab. Als man diese Binnenzölle dann 1969 völlig abschaffte,geriet die gesamte deutsche Alkoholwirtschaft in eine schwierige Lage, die bis weit in die 70er Jahre andauern sollte.
Die Stadtsanierung
Nur zwei Jahre vor dem Wegfall der Binnenzölle, am 2. Juni 1967, hatte der Sendenhorster Rat den Beschluss zur Durchführung einer Stadtsanierung gefasst. Neben anderen Kriterien stellten die „für die
Bewohner unzumutbaren Geruchsbelästigungen“ der noch immer acht im Zentrum der Stadt ansässigen Brennereien und Landwirtschaften mit ihren Großviehställen ein wichtiges Argument dar. Dazu gehörten
die Brennereibetriebe Graute, Rötering, Arens-Sommersell, Hallermann (früher Panning), Jönsthövel, Everke, Lainck-Vissing und Silling (Oststraße). Mit Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidenten
in Münster wurde dem Antrag der Stadt auf Förderung eines ersten Sanierungsabschnittes mit dem Schwerpunkt der Verlagerung der störenden Betriebe entsprochen. Zwei weitere Sanierungsabschnitte
folgten. Alle Sendenhorster Brennereien im Stadtkern mit den zugehörigen Wirtschaftsgebäuden wurden abgerissen. Zahlreiche repräsentative und teilweise auch kulturhistorisch interessante Wohnhäuser
ereilte dasselbe Schicksal. Zurück blieben städtebaulich wertvolleLücken im historisch gewachsenen Umfeld. Sie wurden alsbald mit funktionalen Architekturen gefüllt, die nichts mehr mit der früheren
Bebauung gemein hatten und das Bild der Stadt veränderten. Nicht nur Neubürgern fällt es heute schwer, sich das Leben und die Atmosphäre in dem ehemaligen Ackerbürger- und Brennereistädtchen vor der
Stadtsanierung vorzustellen!
Auf den nächsten Seiten soll deshalb mit historischem und neuem Bildmaterial das „alte Sendenhorst“ vor der Sanierung dem der Gegenwart gegenüber gestellt werden. Neben den acht oben aufgelisteten
Brennereibetrieben, die direkt im Stadtkern und damit im Sanierungsgebiet lagen, werden auch alte und neue Ansichten anderer ehe- maligerBrennereigrundstücke gezeigt, die aufgrund ihrer Lage im
Kirchspiel oder am Rande der Stadt zwar nicht direkt von der Sanierung betroffen waren, jedoch im Zug der allgemeinen Modernisierung ihr Aussehen inzwischen verändert haben.
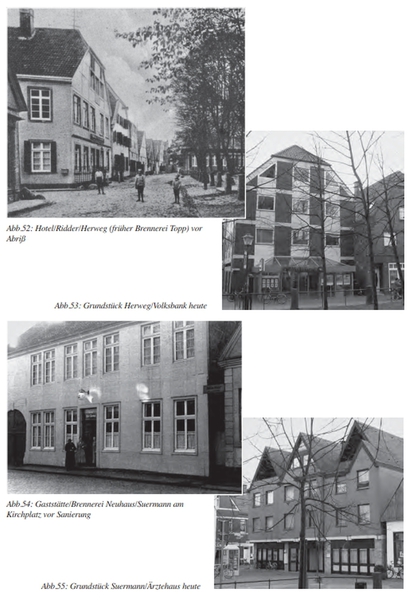

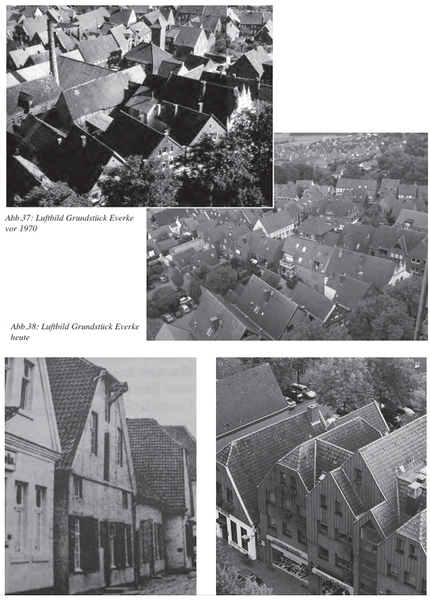
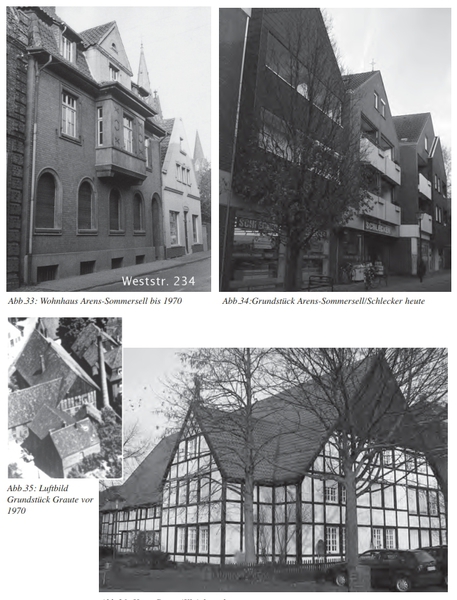
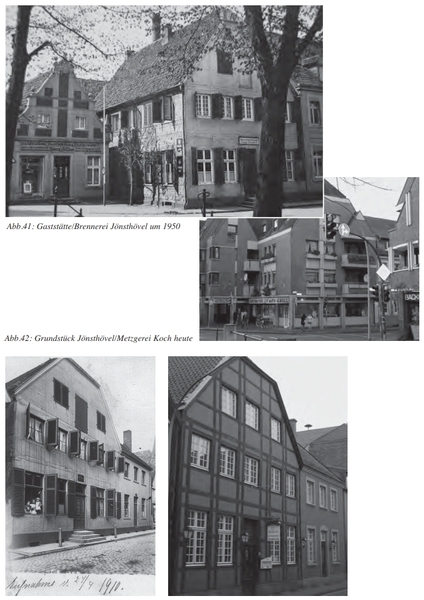
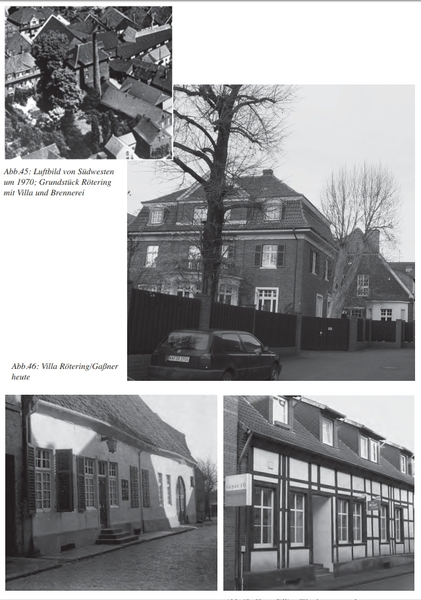
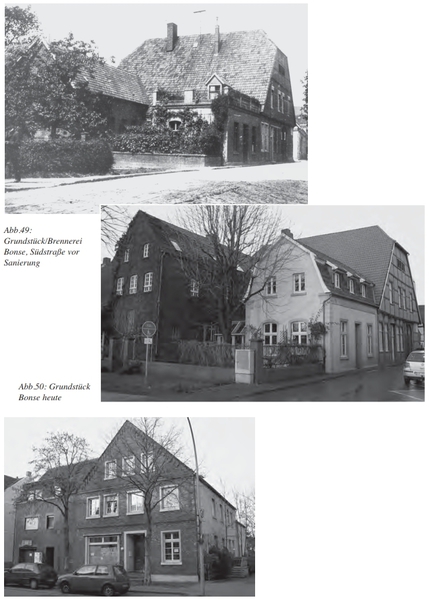 Brennerei-Grundstücke im Bild - vor und nach der Stadtsanierung
Brennerei-Grundstücke im Bild - vor und nach der Stadtsanierung
Abb.33: Wohnhaus Arens-Sommersell bis 1970
Abb.34:Grundstück Arens-Sommersell/Schlecker heute
Abb.36: Haus Graute/Kleinhans heute
Abb.39: Wohnhaus Hallermann/Panning vor 1970
Abb.40: Grundstück Panning/Wiedehage heute
Abb.43: Gaststätte/Brennerei Lainck- Vissing/Hankmann 1910
Abb.44: Haus Hankmann/Börse heute
Abb.47: Gaststätte/Brennerei Silling, Oststraße vor 1970 Abb.48: Haus Silling/Westhagemann heute
Abb.51: Haus Silling, Weststraße heute Brennereien im Kirchspiel
Abb.61: Ehemaliges Brennereigebäude Hof Vrede/Bauerschaft Rinkhöven heute
Abb.62: Hof Werring mit altem Wohnhaus und Brennerei (vor 1920)
Abb.62b: Hof Werring mit neuem Wohnhaus
Abb.63: Brennerei Werring heute
Fazit
Mit den Brennereien Arens-Sommersell, Horstmann und Werring gibt es heute noch drei Kornbrennereien im Kirchspiel Sendenhorst, wobei nur noch die Erlebnisbrennereien Horstmann in der Bauerschaft
Rinkhöven echten Sendenhorster Korn selbst herstellen undvermarkten.
Update 2019: Der Fall des Branntweinmonopols hat den Prozess des Sterbens erheblich beschleunigt.Die Bundesregierung hat am 28.11.2012 das Gesetz zur Abschaffung des Branntweinmonopols beschlossen.
Die staatlichen Beihilfen für landwirtschaftliche Brennereien liefen damit Ende 2013 aus. Die Bundesregierung folgte mit dem Gesetzentwurf einer EU-Vorgabe. Die gesetzliche Regelung schaffte das
ursprünglich von Kaiser Wilhelm II im Jahr 1918 errichtete Branntweinmonopol ab.
Die Bundesregierung hat am 28.11.2012 den Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung des Branntweinmonopols beschlossen. Die staatlichen Beihilfen für größere landwirtschaftliche Brennereien laufen Ende
2013 aus. Für Klein- und Obstbrennereien gibt es eine längere Übergangsfrist. Für sie soll das Branntweinmonopol erst 2017 enden. Die Bundesregierung folgt mit dem Gesetzentwurf einer EU-Vorgabe. Der
vorliegende Gesetzentwurf schafft darüber hinaus mit der beschlossenen Anschlussregelung (Alkoholsteuergesetz) Rechts- und Planungssicherheit. Die neue gesetzliche Regelung schafft das ursprünglich
von Kaiser Wilhelm II im Jahr 1918 errichtete Branntweinmonopol ab. Die Bundesregierung hat am 28.11.2012 den Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung des Branntweinmonopols beschlossen. Die
staatlichen Beihilfen für größere landwirtschaftliche Brennereien laufen Ende 2013 aus. Für Klein- und Obstbrennereien gibt es eine längere Übergangsfrist. Für sie soll das Branntweinmonopol erst
2017 enden. Die Bundesregierung folgt mit dem Gesetzentwurf einer EU-Vorgabe. Der vorliegende Gesetzentwurf schafft darüber hinaus mit der beschlossenen Anschlussregelung (Alkoholsteuergesetz)
Rechts- und Planungssicherheit. Die neue gesetzliche Regelung schafft das ursprünglich von Kaiser Wilhelm II im Jahr 1918 errichtete Branntweinmonopol ab. Die Bundesregierung hat am 28.11.2012 den
Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung des Branntweinmonopols beschlossen. Die staatlichen Beihilfen für größere landwirtschaftliche Brennereien laufen Ende 2013 aus. Für Klein- und Obstbrennereien
gibt es eine längere Übergangsfrist. Für sie soll das Branntweinmonopol erst 2017 enden. Die Bundesregierung folgt mit dem Gesetzentwurf einer EU-Vorgabe. Der vorliegende Gesetzentwurf schafft
darüber hinaus mit der beschlossenen Anschlussregelung (Alkoholsteuergesetz) Rechts- und Planungssicherheit. Die neue gesetzliche Regelung schafft das ursprünglich von Kaiser Wilhelm II im Jahr 1918
errichtete Branntweinmonopol ab.
Die Erlebnisbrennereien Horstmann sind der letzte Betrieb in Sendenhorst, Schulze Rötering kurz hinter der Ahlener Stadtgrenze, verwendet noch Original "Sendenhorster Wasser" zur Alkoholerstellung.
Das war's...
Die Vermarktung des Sendenhorster Korns
Unter dem Datum 30. Dezember 1847 gab der Bürgermeister Kreuzhage im Öffent- lichen Anzeiger bekannt, der Colon Werring in der Elmenhorster Bauerschaft beab- sichtige, in seinem Nebengebäude Nr. 1c
eine Branntweinbrennerei anzulegen. Die “Concession“ zum Betrieb und damit die offizielle Gründung der Brennerei Werring erfolgte wenige Monate später. Von diesem Zeitpunkt an führte der Colon
Werring ein „Branntweinbuch“, in dem penibel Lieferdatum, Kundennamen, Berufsbezeichnung, Adresse, Liefermenge, Preis pro Liter und Gesamtpreis verzeichnet wurden. Auch in den Familienarchiven
anderer SendenhorsterBrennereien finden sich noch solcheVertriebsbücher, von denen vier im Hinblick auf einige interessante Informationen exemplarisch ausgewertet wurden.
Der Vertrieb des Kornbranntweins
Im Archiv der Familie Schulze Rötering befindet sich ein großformatiges, prächtiges Kundenbuch, in dem für den Zeitraum 1822-1856 alle Branntweinlieferungen einge- tragen sind. Eine Auswertung dieses
Geschäftsbuches hinsichtlich der Vertriebsorte ergab Erstaunliches: Theodor Schwarte, der 1807 in die Sendenhorster Brennerfamilie Fiehe eingeheiratet hatte und der den Betrieb bis 1857 führte, hatte
bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur Kunden in Sendenhorst, Münster und zahlreichen kleineren Orten in der näheren Umgebung; er verschickte seinen Kornbranntwein über weite
Strecken in alle Himmelsrichtungen – in das damals noch nicht so entwickelte Ruhrgebiet, an den Niederrhein nach Wesel, nach Ahaus, Greven, Bielefeld und in das Sauerland (vgl. dazu Grafik 1). Wie
kam ein Sendenhorster Betrieb an diese relativ weit entfernten Abnehmer? Was machte den Schwarte-Korn so begehrenswert? Wie schaffte man es überhaupt, mit der damals noch wenig entwickelten
Brenntechnik größere Mengen zu produzieren und wie organisierte man den Transport angesichts der Tatsache, dass es weder Eisenbahn noch Autos gab, die Lieferungen also mit Pferd und Wagen erfolgen
mussten? Fragen über Fragen, die aufgrund unzureichender Quellenlage leider im Moment nicht beant- wortet werdenkönnen, die es aber wert wären, sie zu einem späteren Zeitpunkt näher zu untersuchen.
Wie die Grafik 2 zu den Vertriebswegen der Brennerei Werring im Zeitraum 1848- 1867 zeigt, war die Mehrzahl der Kunden dieses damals neu gegründeten Betriebes in der direkten Umgebung ansässig - der
eigenen Bauerschaft Elmenhorst, der Stadt Sendenhorst sowie in Albersloh, Alverskirchen, Drensteinfurt und Wolbeck. Der Abnehmerkreis für den Werringschen Korn war aber bereits in den ersten
Betriebs- jahren keinesfalls nur darauf beschränkt. So hatte man eine ganze Reihe von privaten und geschäftlichen Kunden aus Münster und Hiltrup, aus Ahlen, Amelsbüren, Everswinkel, Harsewinkel,
Herbern, Hoetmar, Füchtorf, Lippstadt, Sassenberg, Telgte, Warendorf und Vreden. Und wie die oben erwähnte Brennerei Schwarte lieferte man in das damals im Aufbau begriffene Ruhrgebiet nach Dortmund
und Duisburg, wo der Sendenhorster Korn vor allem den Bergarbeitern in den zahlreichen Zechen die Arbeit erleichtern sollte
Lieferorte Brennerei Rötering 1822 - 1856 - Ahlen - Freckenhorst - Albersloh - Münster - Alverskirchen - Nienberge - Ascheberg - Ostbevern - Beckum - Telgte - Enniger - Wolbeck - Everswinkel -
Eichen/Siegen – 140 km
Grafik 1: Lieferorte Brennerei Theodor Schwarte 1822-1856 Lieferorte Brennerei Werring
Grafik 2: Branntwein-Vertrieb Brennerei Werring (1848-1867
Grafik 3: Branntwein-Vertrieb Brennerei Werring (1900-1918) Erfurt - 362 km,Friedersdorf (Brdbg) - 525 km
Die zweite Grafik zum Vertrieb der Brennerei Werring stellt den Branntweinverkauf im Zeitraum 1900-1918, also 40 Jahre später, dar. Sie zeigt ein erweitertesVertriebsnetz, sowohl was die Anzahl und
Größe als auch die Entfernung der Orte vom Herstellungsbetrieb Werring angeht.
Grafik 4: Branntwein-Vertrieb Brennerei Horstmann (1930-1940)
Wie früher gab man den hauseigenen Korn regelmäßig und zum Teil in erheblichen Mengen an Privatleute in der Nachbarschaft und in Sendenhorst sowie bestimmte ortsansässige Gastwirtschaften ab (u.a.
Werring, Suermann, Kogge, Flechtker Herbergswirth, Schulte Kaufmann/später Angelkort, Spiegel/Bahnhofsrestaurant, Selige/Peiler). Auch Handwerks- und Handelsbetriebe waren treue Kunden (erwähnt
werden die Bezeichnungen Maler, Schmiede, Sägewerk, Böttcher, Sattler, Schneider, Stuhlmacher, Holzschuhmacher, Tischler Baugewerbe, Kaufleute, Bäcker). Die Lieferungen an Orte im Ruhrgebiet wurden
beibehalten bzw. ausgeweitet. Nun aber hatte man auch vermehrt Abnehmer jenseits des bisherigen Vertriebsgebietes, die den Werringschen Korn in weit größeren Mengen orderten. Dazu gehörten neben
anderen Brennereien bzw. Betrieben, die den Rohbrand zur Weiterverarbeitung benötigten (u.a. Friedrich Schwarze/Oelde; Gebr. Meyer in Hille) zahlreiche Schankwirtschaften, Restaurants und
Hotelbetriebe in Münster und den umliegenden Orten, die teilweise dem Kreis der Verwandtschaft angehörten (u.a. Gastwirtschaften Anton/Theodor Werring in Coesfeld; Hub. Werring in Datteln; Th.
Werring/Restaurant zum Prinzen Heinrich in Gronau). Ein besonders wertvoller Kunde dürfte die Westfälische Landesbahn und ihre zahlreichen Bahnhofsrestaurants gewesen sein. So lieferte man z.B. in
den Jahren 1911-1915 an den Bahnhofswirt Borgmann in Münster mehr als 11.000 Liter Korn pro Jahr!
Nach der Einführung des Branntweinmonopols im Jahre 1919 gaben die Sendenhorster Brennereien entsprechend ihres Brennrechts bzw. Brennkontingentes und gegen feste Übernahmepreise einen Großteil des
sog. Rohbrandes an die Monopolverwaltung ab. Nun verarbeitete man nur noch die Mengen zu trinkfähigem Korn, die man auch vermarkten konnte.
Grafik 4 beschäftigt sich mit dem Kornvertrieb der Brennerei Horstmann in den Jahren 1930-1940. Man besaß zur damaligen Zeit ein Brennrecht von 260 Hektolitern, von denen ca. 80 % selbst vermarktet
wurden. Auch für diesen Betrieb war das direkte Umfeld – dasKirchspiel und der Ort Sendenhorst – ein wichtiges Absatzgebiet. So ver- sorgte man regelmäßig zahlreiche ortsansässige Gaststätten
(B.Werring, Siekmann, Angelkort, Kogge, Peiler, Suermann, Haskie/Bahnhofswirt), Handwerksbetriebe und Privatkunden mit demhauseigenen Korn und Doppelkorn, der in verhältnismässig klei- nen Mengen in
Flaschen, Korbflaschen (5-25 Liter), „Fässchen“ (16 Liter) oder auch grö- ßere Fässer abgefüllt wurde. In Münster hatte man mit der Gaststätte Meier einen treuen Kunden, der in den 10 Jahren
insgesamt 67 Lieferungen Korn, Doppelkorn,Wacholder (insgesamt .ca. 10.000 Liter) und auch zwei Mal große Mengen von Eiern bezog. Daneben aber lieferte man auch an weiter entfernt liegende Orte im
Ruhrgebiet, sowie nach Bonn, Köln, Erfurt und sogar Friedersdorf in Brandenburg! Offenbar gehörten zum Kundenkreis auch Gaststätten und Betriebe in Brakel, Gladbeck, Lünen, Sechlem und Wesseling, die
zum weiteren Kreis der Familie Horstmann gehörten. Abhängig von der Größe des Betriebes und des Brennrechtes, aber auch dem Kreis der Kunden war die Art und Weise des Kornbranntweinvertriebes bei den
Sendenhorster Brennereien sehr unterschiedlich. Es gab Brenner, die, wie der Bauer Telges Homann oder die städtischen Betriebe Rötering und Everke, ihren Korn im concessionierten Kleinhandel in einem
Raum des Hauses direkt vertrieben.
Abb.64: Wohnhaus Telges-Homann (um 1946)
Abb.65: Im Namen des Volkes! Urteil zugunsten Telges-Homann i.S. Kleinhandel (1934)
Abb.66: Plan zum Concessionsbescheid 1931 für Kleinhandel in der Diele des Hauses Rötering an der Weststraße
Wie in den o.g. Grafiken dargestellt wurde, vermarkteten die Sendenhorster Kornbrenner ihre Produkte auch an auswärtige Kunden, entweder in Eigenregie oder mit Hilfe von angestellten Vertretern oder
Großhändlern. Teilweise lieferte man weit über die GrenzenWestfalens hinaus, wobei die Kontakte nicht selten durch verwandt- schaftliche Beziehungen hergestellt wurden. Abb. 68 zeigt Josef
Arens-Sommersell, der mit seinem Kutschwagen ein Fass Münsterländer Korn zur Bahn bringt, das nach Schlesien verschickt werden sollte, Abb. 69 den LKW der Brauerei Werring zum Vertrieb der
Produkte.
Abb.67: Legitimationskarte für inländische Kaufleute, Handlungsreisende und Handlungsagenten für Josef Arens (1931)
Abb.68: Josef Arens auf Kutschwagen mit Fass Münsterländer Korn
Abb.69: LKW zum Vertrieb der Produkte der Brennerei Werring
Die relativ kleinen Brennereien Jönsthövel und Silling in der Oststraße betrieben eine Gaststätte, in der der hauseigene Korn direkt ausgeschänkt wurde. Wie dieser Ausschank funktionierte und welche
Bedeutung diese Häuser innerhalb des kommu- nalen Lebens hatten, wird aus den folgenden Erinnerungen zweier Sendenhorster Bürger deutlich.
Die Gastwirtschaft und Brennerei Jönsthövel (von Hermine Schulte)
Der Betrieb Jönsthövel, an der Ecke Schulstraße/Nordstraße (heute Metzgerei Koch) in direkter Nachbarschaft zu dem damaligen Haus Pöttken und der Post (Borgmann) lag,
Abb.70: Luftbild Gesamtkomplex Jönsthövel (um 1970)
bestand aus einer kleinen Landwirtschaft mit Brennerei und einer Gastwirtschaft. Zumindest noch bis 1942 wurden hier auch einige Haushalts- und Grundnahrungsmittel wie z.B. Zucker, Salz, Hoffmanns
Stärke, das Waschpulver Sil, Soda, Ata, Petroleum und Kernseife oder auch das „Panama“ (ein besonderes Handwaschmittel für die schwarzen Schürzen, die viele Sendenhorster Frauen trugen), verkauft.
All diese Waren lagerten hin- ter der Theke in großen Schubladen. Die Gaststätte – sie gehörte im Leben unserer Familie einfach so dazu. Der Gaststättenbetrieb hatte keinen besonderen Stellenwert. Es
gab lediglich einige
Abb.70a: Gaststätte Jönsthövel mit Haus Pöttken (um 1950)
Spirituosen, darunter auch „Een ut de Strük“. Es handelte sich hier um eine Art Magenbitter, einen Schnaps, der durch einen beigegebenen Wermutzweig einen besonde- ren Geschmack erhielt undsehr gut
bei Magenverstimmunghalf. Abends wurde generell um 22.00 Uhr die Türe abgeschlossen.Dann gingen mein Onkel und ich noch einmal durch den Stall, um nachzusehen, ob mit demVieh alles in Ordnung war.
Wir hatten 25 Kühe bzw. in späteren Jahren Bullen. Anschließend ging es in die Brennerei, wo wir noch ein wenig Kohle auf die Glut legten, damit der Kessel am Morgen wieder schneller auf Touren kam.
Der Grundriss des Hauses Jönsthövel war iden- tisch mit dem der Familie Lainck Vissing, der heutigen Gastwirtschaft Börse. Nach dem gro- ßen Brand von 1806 wurden beide Häuser von demselben Architekt
gebaut. Die Diele und der große Raum rechts bei Vissing entsprach dem Gastraum bei Jönsthövel.
Sowohl bei Vissing als auch bei Jönsthövel befand sich auf der linken Seite der Diele eine
Abb.71: Petroleumkanne aus der Gaststätte Jönsthövel Treppe, die in das Obergeschoss führte; ein schmaler Gang, an dem links ein kleines Stübchen und rechts die Küche lagen, führte in den hinteren
Bereich der Häuser.
Zu der Gaststätte gehörte auch ein sog. „Bauernpferdestall“ aus zwölf Boxen. Hier konnten die Bauern, die in die Stadt kamen, weil sie während der Woche etwas zu erledigen hatten oder aber am
Feiertag am Kirchgang oder einer ande- ren Festlichkeit teilnahmen, ihre Pferde einstellen, während die Wagen und Kutschen auf der Straße stehen blieben. Ein 15jähriger Junge, Rudi Höfling, half beim
Ein- und Ausspannen. Das Einstellen der Pferde war übrigens kostenlos. Allerdings nahmen diesen Service nur ganz bestimmte Bauern in Anspruch. Ich erinnere mich an die Namen Horstrup-Volking,
Erdmann,
Abb.72: Grundriss der Gaststätte und des Wohnhauses Lainck-Vissing/Hankmann
Abb.73: Diele/Gastraum der Gaststätte Lainck-Vissing
Tacke, Bockholt, Büttendorf und Westhues. Sie gehör- ten zu der Bauerschaft Elmenhorst, die Richtung Telgte liegt.Wir hatten ein sehr persönliches Verhältnis zu diesen Familien, so dass man auch
grundsätzlich zu Hochzeiten und anderen Feiern eingeladen wurde. Während der Woche und vor allem nach dem Kirchgang hielten sich die Männer in unserer Gaststätte auf, um mit Bekannten, Viehhändlern,
Handwerkern usw. Gespräche zu führen, Termine abzustimmen und Neuigkeiten zu erfahren. Ihre Frauen saßen währenddessen mit ihren Kindern im sog. „Stübchen“ und tranken Kaffee. Dazu gab es Zwieback.
Sie warteten geduldig, bis ihre Männer fer- tig waren. Kaffee und Zwieback waren für sie kosten- los; die Männer aber mussten für ihre Getränke bezah- len. Oft brachten die Bauern Korbflaschen mit,
die bei Jönsthövel gefüllt und dann wieder nach Hause mitge- nommen wurden.
Abb.74: Standuhr aus der Gaststätte Jönsthövel (heute Haus Schulte/Ahlen)
Abb.75: Schulstraße mit Kutschen vor dem Ausspannhof Jönsthövel
Abb.76: Befüllung einer Korbflasche mit Trichter (Hermine Schulte)
Abb.77: Hermine Schulte mit diversen Geräten aus Brennerei und Gaststätte Jönsthövel
Es waren meistens 5-Liter- und seltener 10-Liter-Flaschen, die je nach Familie ganz unterschiedlich aussahen. Bauer Erdmann hatte z.B. eine besonders schöne. Sie war aus heller Weide geflochten mit
einem Korbverschluss darauf. Jönsthövel hatte natürlich auch eigene Behälter, aber die meisten Familien brachten ihre eigene Flasche mit. Einige kamen auch nur mit ihrem „Plattmenken“. Es wurde ja
hart gearbeitet und es war in vielen Haushalten üblich, dass die Helfer mittags und abends vor dem Essen ein oder zwei Schnäpsebekamen. Wir hatten eine landwirtschaftliche Brennerei. Alle „An- und
Abfälle“ aus der Brennerei und der Landwirtschaft wie z.B. die in der Brennerei anfallende Schlempe, mussten innerhalb des Betriebes verwendet werden. Unsere Landwirtschaft war nicht groß und so
hatte mein Onkel von der Kirche und einigen Bauern Land dazu gepach- tet. Die Pacht, die dem Generalvikariat in Münster zustand, wurde durch Herrn Lammerding eingezogen, der dafür einmal im Jahr zu
uns ins Haus kam. Mühsam war die Einlagerung des Getreides für die Brennerei auf dem Dachboden des Wohnhauses. Die Säcke, die auf einem Wagen, der vor der Gaststätte Jönsthövel auf der Straße stand,
lagen, wurden über einen Balkenaufzug zum Speicher hochgezogen.
Abb.79: Luftbild Brennerei Jönsthövel
Abb.78: Alte Schnapsgläser aus der Gaststätte Jönsthövel
Abb.80: Kutschwagen vor Jönsthövel
Dort wurde das Getreide zur Trocknung und Lagerung aus- geschüttet und immer wieder mit großen Schippen umge- schlagen. Bei Bedarffüllte man das Korn wieder in Säcke, die dann auf der anderen Seite
des Speichers zur Brennerei her- untergelassen wurden. Da es von der Straße keine Einfahrt in den Innenhof gab,hätte man die Getreidesäcke für die Brennerei nur mit Sackkarren dorthin befördern
können.
Abb.81: Theodor Jönsthövel
Abb.82: Theodor Jönsthövel mit Jagdgenossen, darunter die Kornbrenner Willi Hankmann, Heinz Everke, und Reinhold
Zurmühlen.
Wir hatten einen Brenner, Herrn Linnemann vom Schleiten. Mein Onkel brannte nicht selbst; er führte mehr die Aufsicht über alle Bereiche des Betriebes. Daneben ging er gerne zur Jagd und war lange
Vorsitzender des Jagdbezirkes 2. Anfang der 50er Jahre wurden das alte Brennereigebäude und der Schornstein abge- rissen und eine neue Anlage errichtet. Auch einneuer, größerer Dampfkessel, ein sog.
Wellrohrkessel, der immerhin 25.000, - RMkostete, wurde angeschafft. Das war damals sehr viel Geld und wir mussten für diese Investition am Südendamm ein Grundstück verkaufen. Als ich älter war,
wurde ich heran- gezogen, Rechnungen zu schreiben, Wareneingangsbücher zu führen oder anderen Schriftverkehr zu erle- digen. Später vertraute mir mein Onkel, der selbst keinen Führer- schein besaß,
den Schnapsverkauf an. Wir hatten einen Mercedes mit Anhänger, mit dem die 10-Liter- und 25-Liter-Korbflaschen zu den Kunden gebracht wurden.
Abb.83: Mercedes der Familie Jönsthövel, mit dem u.a. auch der Korn zu den Kunden gebracht wurde.
Sie waren sehr schwer und ich hatte sie in die oft unwegsamen, kalten und dunklen Keller zu bringen. Wir haben den Großhändler Proppe in Paderborn beliefert, dann mehrere Händler und Gastwirte in
Münster, Ahlen und Emsdetten, da hier mein Vater viele Verbindungen hatte. Auch in Albersloh hatten wir Kunden wie die Gaststätten Geschermann, Homeyer und Fels. Die Gaststätte Elmenhorst bezog, wohl
auch aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen, regelmäßig Schnaps von uns. Sonst aber gab es inner- halb von Sendenhorst außer den Einzelkunden kaum Nachfrage durch die Gaststätten- betriebe, die
wahrscheinlich von den anderen Brennereien ihren Schnaps bezogen. Als die Allierten 1945 einmarschierten, waren wir gezwungen, innerhalb von einer Stunde unser Haus zu verlassen – und zwar für ein
ganzes Jahr.Wir hatten ja durch die Brennerei viele leere Getreidesäcke im Haus. Mit Hilfe der Nachbarn haben wir es geschafft, inner- halbdieser einen Stunde einen Großteil des Hausrats in die Säcke
zu packen und zum Hof Jönsthövel zu bringen. Trotzdem ist noch Vieles im Haus ge- blieben.Wir lebten dann im Nachbarhaus bei Borgmanns und Mütherigs in zwei Zimmern, einem Wohnzimmer unten und einem
Schlafzimmer im Ober- geschoss.Tagsüber haben wir uns in der Brennerei aufgehalten; gekocht wurde in der Waschküche.
Abb.84: Belgier mit Hermine im Garten Jönsthövel
Beim Einmarsch der Alliierten musste mein Onkel etwas tun, was ihm in der Seele weh tat. Er ließ den Schnaps aus den Fässern in die Gosse laufen. Zwei Gründe gab es dafür: Zum einen hatte man Angst,
dass der hochprozentige Alkohol durch Schüsse explodie- ren würde;zum anderen wollte man nicht, dass er den Besatzern in die Hände fiel. Man hatte auch Sorge um die jungen Frauen und Mädchen, von
denen viele aus Angst vor Vergewaltigungen im Krankenhaus schliefen. Wir hatten aber im Grunde ein sehr gutes Verhältnis zu den belgischen Soldaten, die das Haus Jönsthövel mit der Gaststätte als
Offizierskasino benutzten. Unser Haus war bald gar nicht mehr wieder zu erkennen. Es wurde mit noblen Möbeln, Marmortischen und echten Perserteppichen ausgestattet, von denen wir nicht wussten, woher
sie kamen. (Anmerkung: Es existieren Anforderungslisten der Gemeinde über Möbel,Teppiche usw., die anderen begüterten Sendenhorster Bürgern – darunter auch den Brennern Rötering, Lainck Vissing,
Everke – zugestellt wurden).
Abb.85: Erfassungsbescheid an Heinrich Roetering wegen Anforderung von Teppichen für Militärregierung
Nach einem Jahr zogen die Belgier ab und wir bekamen die Genehmigung, wieder in unser Haus zu ziehen. Bald darauf haben wir nach einer grundlegenden Sanierung der Räume unsere Gaststätte wieder
eröffnet. Dann aber kam die Ernüchterung.Viele der alten Gästeblieben aus. Man hatte sich offensichtlich in diesem einen Jahr anders ori- entiert und ging nun zu Kaupmann oder Herweg. 1954 machte ich
den Führerschein und war fortan dafür zuständig, den Jönsthövelschen schwarzen Mercedes, der ab 1949 unser Eigentum war, zu fahren. Er wurde nicht nur im Schnapsverkauf sondern auch für diverse
andere Aufgaben eingesetzt. So fuhr ich bei Beerdigungen auf dem Anhänger häufig die Kränze zum Friedhof und bei Hochzeiten wurden die Brautleute damit kutschiert. Daneben aber wurden auf dem
Anhänger auch die Deputatsschweine für die Helfer, die bei uns gearbeitet hatten, transportiert. Zum Schluss soll noch etwas zur Stadtsanierung und dem Abriss des Hauses Jönsthövel, den viele
bedauert haben, gesagt werden. Im Zuge dieser Sanierung sollten und mussten alle landwirtschaftlichen Betriebe aus der Innenstadt verschwinden. Sie wurden entweder aufgegeben oder ausgesiedelt. Bei
Jönsthövel handelte es sich um einen kleinen Betrieb; eine Auslagerung in die Bauer-
Abb.86: Zeitungsausschnitt zum Abriss des Hauses Jönsthövel
schaft hätte keinen Sinn gemacht. Zudem war mein Onkel zu dieser Zeit bereits ver- storben und die Verwaltung oblag meinem Mann und mir. Die Gaststätte wurde zunächst durch drei aufeinander folgende
Pächter genutzt, was nur Schwierigkeiten brachte. Dazu muss man sagen, dass zur damaligen Zeit solche Betriebe eigentlich immer im Eigentum der Betreiber waren; Vermietung und Verpachtung war in
Sendenhorst keineswegs so üblich wie heute. All unsere Überlegungen konzentrierten sich dann im Rahmen der Stadtsanierung auf das Wohnhaus bzw. den Erhalt der Fassade, die allerdings bereits eine
Veränderung erfahren hatte. Ursprünglich hatten wir, genauso wie die Post, eine schöne Treppe vor dem Haus.Irgendwann wurde angeordnet, dass alle Treppen in das Haus hinein verlegt werden mussten.
Nur bei Graute (heute Kleinhans) wurde eine Ausnahme gemacht. Dazu kam, dass die Räume im Untergeschoss des Hauses sehr hoch waren; dagegen konnte man imObergeschoss gerade einmal stehen. Eine
Veränderung der Decken bei gleichzeitiger Erhaltung der Fassade wäre kaum möglich gewesen. Zudem mussten die ganzen sanitären Anlagen modernisiert werden. Wir hatten zwar eine Toilette mit
Wasserspülung, aber auf dem Hof! Alles zusammen genommen wäre ein finanzieller Aufwand gewesen, den wir zu der damaligen Zeit aus verschiedenen Gründen einfach nicht tragen konnten. Heute würde ich
wahrscheinlich anders entscheiden. Ich würde den hinteren Teil, die Stallungen und die Brennerei, verkaufen und mit dem Erlös das Wohnhaus sanieren, um es dann zu vermieten.
Abb.87: Vor der Gaststätte Jönsthövel
Opas Flachmann und „Osten-Silling“ (Bernd Höne)
Mein Großvater Heinrich Höne war durch seinen Maurerberuf in einem gewissen Maße dem Alkohol verpflichtet. Als alter Mann verlangte er jeden Abend vor dem Schlafengehen einen „Flachmann“ mit Korn,
der ihn nach etwa einer halben Stunde so fröhlich stimmte.
Abb.88: Großvater Höne mit Familie (links Bernd Höne)
Es war für mich als etwa 8jährigem Jungen meine tägliche Aufgabe, für den Flachmann zu sorgen. Opa gab mir für den Einkauf die leere Flasche und 1,50 DM. Gegen Spätnachmittag fuhr ich dann mit dem
Fahrrad zur Brennerei und Gaststätte Silling an der Oststraße. Josef Silling füllte die Flasche mit Korn auf und ich bezahlte mit 1,50 DM. Mein Opa erwartete mich nach der Rückkehr bereits in seinem
Bett. Dort nahm er seinen Korn zu sich. Auf dem Weg zu Silling kam ich täglich an der Bäckerei Drees vorbei, wo es auch Eis zu kaufen gab. Abb.89: Blick von St. Martin auf die Oststraße bzw. die
Häuser Silling und Drees auf der linken Seite Ein Eis kostete 10 Pfennig, aber es gab auch schon ein halbes für 5 Pfennig. Nun war es gerade ein heißer Sommer und viele Kinder lutschten ein Eis.
Leider verfügte ich nicht über die finanziellen Mittel für einen solchen Genuss. Ich bekam weder Taschengeld noch hatte ich ein Sparguthaben. Meine Eltern meinten, das müsse auch nicht sein. Aber war
es nicht ungerecht, dass andere Kinder ein Eis lutschten, ich mir aber keines kaufen konnte? An einem heißen Nachmittag konnte ich dem Wunsch nicht mehr widerstehen. So kaufte ich mir von Opas Geld
für 5 Pfennig ein halbes Eis. Mit den restlichen 1.45 DM und dem Eis in der Hand ging ich nun zu Silling. „Heute nur für 1.45 DM“, sagte ich mit Herzklopfen. Silling sah mich und das Eis kurz an und
füllte dann etwas weniger Korn ein. Zuhause füllte ich den Flachmann mit Wasser auf, bevor ich ihn Opa über- gab, der seinen Korn mit Behagen genoss.
Der Sommer blieb weiterhin heiß und immer öfter ging ich meinem „Mundraub“ nach, war doch somit meinem Opa wie auch mir bestens gedient. Leider muss ich mir an die- ser Stelle den Vorwurf machen,
dass ich mich nach einiger Zeit mit der für uns beide so glücklichen Lösung nicht mehr zufrieden geben konnte. Aber kauften nicht viele ande- re Kinder ein Eis für 10 Pfennig, ich aber nur für 5? So
verschob ich Opas und meinen Anteil um 5 Pfennig zu meinen Gunsten und kaufte mir für 10 Pfennig ein Eis. Die grö- ßer werdende Lücke in der Flasche füllte ich wie gewohnt mit Wasser auf. Opa wartete
schon in seinem Zimmer auf mich und seinen Flachmann. Er richtete sich bei meinem Nahen in seinem Bett auf und nahm den ersten Schluck. Bestimmt würde er sich jetzt so wie immer in die Kissen fallen
lassen. Das würde für ihn der schönsteMoment des Tages sein. Plötzlich hielt er inne, setzte die Flasche mit starrem Blick ab und schüttelte sich. Er schaute mich an und sagte: „ Du ollen Hund, Du
häs mi Water in’n Schnaps doan!“
Abb.90: Kundenschreiben an die Brennerei Rötering (1941)
Im Zweiten Weltkrieg war sowohl die Herstellung als auch der freie Branntwein- Verkauf nur eingeschränkt möglich. In den letzten Kriegsjahren, in denen man das Getreide zum Backen von Brot dringend
benötigte, wurden mit Ausnahme der Brennerei Everke alle Sendenhorster Brennereien mit einem Brennverbot belegt, das erst 1947 und teilweise noch später durch die sog. Militärregierung aufgehoben
wurde. Im Archiv der Familie Schulze Rötering befinden sich etliche Schreiben von Kunden, die sich in den Kriegsjahren, in denen es Kornbranntwein nur auf Bezugsschein gab, an den Sendenhorster
Betrieb wandten und geradezu flehentlich um Lieferung baten (vgl. Abb. 90). Eine ganz neue Entwicklung brach nach dem Zweiten Weltkrieg an. Etliche der noch bis zum Krieg aktiven Sendenhorster
Brennereien gaben auf, während andere sich durch den Kauf von Brennrechten oder durch Neuveranlagungen stark vergrößerten.
A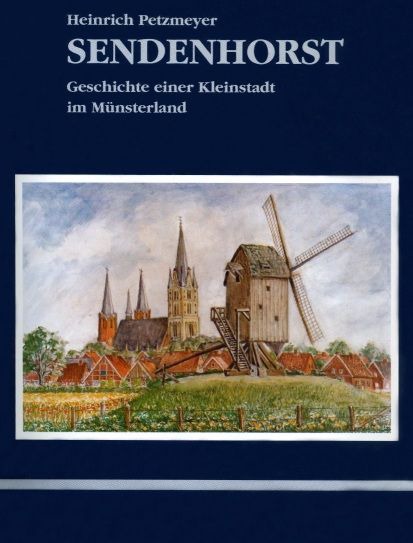 bb.91: Messestand der Brennerei Everke in
Dortmund (um 1950)
bb.91: Messestand der Brennerei Everke in
Dortmund (um 1950)
Werbung und Imagepflege
Im kleinen Brennereistädtchen Sendenhorst sind im 19. und 20 Jahrhundert eine ganze Reihe beachtlicher Brennereibetriebe belegt, die sich alle darum bemühten, ihren hauseigenen Korn zu vermarkten.
Wie aber grenzte man sich gegenüber der Konkurrenz ab; wiemachte man das Besondere der eigenen Marke deutlich? Damals wie heute war es wichtig, ein werbewirksames eigenes Firmenlogo zu haben, das
sich auf allen Briefbögen, Rechnungsblöcken, Flaschenetiketten, Werbetexten usw. wieder fand.
Für die Ausstellung „Schlote, Schnaps und Schlempe“ wurden 220 unterschiedliche noch vorhandene Etiketten der Sendenhorster Brennereien Theodor Bonse /Zurbonsen-Bonse, J.H. Böcker/Lainck-Vissing/W.
Hankmann, Bernhard/Josef Arens-Sommersell, Theodor Jönsthövel, H. Brüning, J.H. Everke, Carl Werring, Peter/Josef/Jochen Horstmann auf einem 2,20 x 1,20 m großen Brett zusammenge- stellt (vgl. Abb.
92). Die Vielfalt an Farben, Emblemen und Schriften, aber auch an Schnaps- und Likörsorten, die im Laufe der Zeit hergestellt wurden, gibt ein eindrucksvolles Bild von dem Geschäftssinn, dem
Einfallsreichtum und dem Willen, die eigene Brennerei und den hergestellten Korn werbewirksam zu vermarkten. Neben dem 32%igen „Münsterländer Korn“, Wacholder und Anis und den 38 %igen
Doppelkornvarianten produzierten einige Sendenhorster Kornbrenner (u.a. Everke, Werring und heute Horstmann) in der Zeit nach 1945 eine geradezu unglaubliche Anzahlunterschiedlichster Likörsorten,
die zwischen 20 und 40 % Alkoholgehalt auf- wiesen. Dazu gehörten u.a. das sog. Danziger Goldwasser und Vanille-, Zitronen-, Apfel-, Kümmel-, Mokka- und Mocca-Kirschliköre. Daneben gab es so
interessant klingende Bezeichnungen wie Schwedenpunsch, Schimmelreiter, Sendenhorster Jagdschluck, Boonekamp und Kurfürstlicher Magenbitter. Es mag sein, dass der Kontakt zu den alliierten Besatzern
dazu beitrug, dass manche Liköre höchst „exoti- sche“ Namen trugen wie „Blackberry, Cherry und Apricot Brandy“, „Curacao triple sec“ und „Creme de Menthe“. Offenbar achteten die Sendenhorster
Kornbrenner sehr auf eine individuelle Gestaltung der Etiketten, die ja das Aushängeschild des Brennereibetriebes waren. Während der eine ein – frühes – Gründungsdatum betont, heben sich andere mit
ihrem Namen, bestimmten bodenständigen Logos (z.B. das Westfalenross, Getreideähren), auffälligen Farben oder Schriften ab. Kunstsinnige Sendenhorster Bürger wie Theodor Borgmann wurden mit den
Entwürfen beauftragt, wobei man, wie im Fall der Brennerei Vissing, die die Figur desFalstaff als Gallionsfigur vorschlug, oft sehr genaue eigene Vorstellungen verwirklicht sehen wollte (Abb.
93).
Abb.92: Ausstellung – Platte mit Etiketten Sendenhorster Brennereien
Abb.93: Ettikett der Brennerei Vissing mit Falstaff-Figur Abb.94: Etikett der Brennerei Werring mit Sämann
Als um 1910 in Sendenhorst die erste Litfasssäule errichtet wurde, waren es die Brenner, die sie, wie in dem Zeitungsausschnitt zu lesen, als erste als Werbefläche nutzten (Abb. 96).
Abb.95: Bestellung von Plakaten durch die Brennerei H.Brüning/Rötering – Auftragsbestätigung (1901)
Abb.96: Zeitungsbericht über die Aufstellung der ersten Litfasssäule in Sendenhorst (um 1900)
Vergrößerte Etiketten dienten zunächst als Poster, mit denen die Litfaßsäule bestückt werden konnte. Doch bald gingen vor allem die größeren Betriebe dazu über, Firmen mit dem Entwurf und der
Herstellung eigener Werbeplakate zu beauftragen (Abb. 95.
Später setzte man Anzeigen und Werbesprüche in Broschüren, Festschriften und Tageszeitungen, mit denen man die Kunden von der Qualität des eigenen Korns über- zeugen wollte. So finden sich z.B. in
der Festschriften der Freiwilligen Feuerwehr Sendenhorst aus dem Jahre 1950 und 1965 Werbetexte der Brennereien Everke, Ferdinand Silling an der Oststraße, Theodor Jönsthövel, Johannes Silling, Carl
Werring, Horstmann, Graute-Hesse, H.Brüning, Bernhard Arens-Sommersell, Lainck-Vissing und Reinhold Zurmühlen.
Abb. 97: Werbung Lainck Vissing 1950
Abb. 98: Werbung Reinhold Zurmühlen 1950
Abb. 99: Werbung Johannes Silling, Weststraße 1950 Abb. 100: Werbung Arens-Sommersell 1950
Abb. 101: Werbung Werring 1965
Sendenhorster Brenner im städtischen Leben
Neben der Darstellung der technischen, baulichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Brennereien war es ein besonderes Anliegen der Ausstellung, der Rolle, die die Sendenhorster Kornbrenner und ihre
Familien im Laufe der Jahrhunderte im kom- munalen Lebenspielten, nachzuspüren. Es ging um die „Schnittstellen“ zur Öffent- lichkeit und damit um Fragestellungen wie
Þ In welchen städtischen und privaten, wirtschaftlichen und karitativen Einrichtungen haben sich Brenner engagiert?
Þ Wo haben sie die Entwicklung der Stadt und des Gemeinwesens mit bestimmt und geprägt? - und
Þ In welcher Art und Weise hat man sich am soziokulturellen Leben beteiligt?
Angesichts der Fülle von Materialien, aber auch auf Grund der im Hinblick auf die einzelnen Betriebe sehr unterschiedlichen Quellenlage, fasste der für die Ausstellung zuständige Arbeitskreis
Stadtgeschichte hinsichtlich der bildhaften Umsetzung einen Entschluss, dersich im Nachhinein als äußerst wertvoll erweisen sollte. Die Besitzer bzw. Angehörigen der ehemaligen oder noch aktiven
Brennereien – es handelt sich um die Familien Arens-Sommersell, Bonse, Horstmann, Jönsthövel, Werring und Rötering - wurden gebeten, selbst einen großen Wechselrahmen über das öffentli- che Wirken
ihrer Familienangehörigen zu gestalten. Die Freiwillige Feuerwehr erklärte sich bereit, für die Familien, die teilweise Jahrzehnte das Wirken dieser Einrichtung mit bestimmt haben – hier ist vor
allem die Familie Everke zu erwähnen, die mit Wilhelm und Heinz Everke von 1907-1967 den Wehrführer stellte – , ein Schaubild zu gestalten. Ein weiterer Rahmen entstand im Arbeitskreis zum Thema
„geselliges Leben“.
Die Folge war, dass sich nicht nur die Brennerfamilien – teilweise zum ersten Mal - intensiv mit ihrer eigenen Geschichte und der des Ortes auseinander setzten; auch viele weitere interessierte
Sendenhorster Bürger trugen mit Bild- und Quellenmaterial zur Gestaltung dieses Themenbereiches bei.
Die Vielfalt des ausgestellten Bildmaterials, das jedoch nur eine begrenzte Auswahl darstellt, lässt ahnen, wie sehr die Kornbrenner in die kommunalpolitische, wirt- schaftliche und soziokulturelle
Entwicklung der Stadt eingebunden waren und das teilweise auch heute noch sind.
Abb.102: Familie Arens-Sommersell zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.103: Familie Bonse zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.104: Familie Jönsthövel zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.105: Familie Schulze Rötering/Gaßner zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.106: Familie Werring zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.107: Rahmen zum Thema „Kornbrenner in der Freiwilligen Feuerwehr“
Die Sendenhorster Banken und die Kornbrenner
Betrachtet man die Gründungsumstände und den weiteren Werdegang von Sparkasse undVolksbank, den beiden am Kirchplatz gelegenen Sendenhorster Banken, dann wird schnell deutlich, dass diese, für die
soziale und wirtschaftliche Entwicklung des ehema- ligen Ackerbürgerstädtchens wichtigen Einrichtungen von Anfang an eng mit den Sendenhorster Kornbrennereien und ihren Besitzern verbunden waren.
1
Abb.108: Sparkasse heute
Die Geschichte der Banken in Sendenhorst reicht von 1867, der offiziellen Eröffnung der Sparkasse, über die Gründung des Spar- und Darlehenskas- senvereins (später Volksbank) im Jahre 1897 bis zur
Gegen- wart. In diesen 140 Jahren haben sich immer wieder enge und für beide Seiten för- derliche Beziehungen zwi- schen den „Kassen“ und den Sendenhorster Brennerei- besitzern ergeben.
So stand die „Wiege“ der Sparkasse in dem Privathaus des Brennereibesitzers Heinrich Brüning, der 1867 zum ersten Rendanten gewählt worden war und nun einen Ge- schäftsraum einrichtete, der bis zum
Umzug der Sparkasse in das neu erbaute Rathaus im Jahre 1911 gute Dienste leistete.
Abb.109: Haus Rötering, Weststraße 13 – „Wiege der Sparkasse“
Abb.110: Kontor des ersten Rendanten der Sparkasse, Heinrich Brüning
1 Alle Informationen in diesem Kapitel wurden den Festschriften der beiden Banken zum 75-jährigem und 100-jährigen Bestehen ent- nommen.Wörtliche Zitate werden zwar gekennzeichnet; auf weitere
Fundstellen-Angaben wird aber verzichtet. Aber auch die Räumlichkei- ten der heutigen Volksbank haben Bezug zu zwei Bren- nereigrundstücken. So kaufte die damalige Spar- und Darlehenskasse 1966 das
an der Ecke Südstraße/Kirchplatz gelegene Hotel Herweg, auf dessen Grundstück noch unter den Vorbesitzern Topp und Ridder eine Brennerei betrie- ben wurde.
Abb.111: Volksbank heute
Kurz darauf, so der ehemalige Bürgermeister Schibill in der Festschrift zum 75-jähri- gen Bestehen der Bank, „fiel das eindrucksvolle alte Fachwerk […] dem wirtschaftli- chen Fortschritt der Zeit zum
Opfer […].“ Nach Plänen des Architekten Nachtigäller entstand nun der allen bekannte, moderne Neubau, der 1968 eingeweiht wurde und in der Folgezeit noch mehrere Erweiterungen erfahren hat.
Abb.112: Hotel Herweg vor dem Abriss im Zuge der Stadtsanierung
Abb.113: Luftbild Neubau Volksbank
Dazu zählt auch die heutige Nutzung einiger Räumlichkeiten im Nachbarhaus Lewe, das bis zum Verkauf im Jahre 1926 der Brennerei- und Brauereibesitzer- familie Wieler gehörte. Das Zusammenwirken
zwischen den Sendenhorster Brennern und den beiden Banken könnte man mit den Worten „Geben und Nehmen“ charakterisieren. Von Anfang an haben etliche Bren- nereibesitzer durch die Übernah- me von
Ämtern oder als ehren- amtliche Mitglieder in Ausschüssen, beratenden Gremien und Kontrollorganen aktiv an der Entstehung und weiteren Entwicklung beider Kassen mitgewirkt. Angesichts ihrer eigenen
wirtschaftlichen Aktivitäten als Landwirte und Brenner hatten sie größtes Interesse an der Entstehung örtlicher Geldinstitute. Diese boten zum einen die Möglichkeit, erwirtschaftetes Geld
gewinnbringend anzulegen. Zum anderen aber stellten Sparkasse undSpar- und Darlehenskasse/Volksbank Beratung und Gelder zur Verfügung für Neu- und Umbauten von Wohnhäusern, Ställen und
Brennereigebäuden sowie die angesichts des technischen Fortschritts und der vergrößerten Brennrechte im 20. Jahr- hundert immer wieder nötigen Modernisierungen der technischen Anlagen der
Betriebe.
Zur Geschichte der Sparkasse
Es war ein langer Weg, bis die Sendenhorster Sparkasse am 12. Mai 1867 offiziell eröff- net werden konnte. Bereits im Jahre 1843 hatte der Oberpräsident von Vincke die Einrichtung örtlicher
Sparkassen gefordert, um weniger begüterte Bürger zum „Sparen für die Not“ anzuregen. Es bedurfte dann jedoch noch 20 weiterer Jahre, bis am 12. Mai 1867 in dem kleinen Ackerbürgerstädtchen
Sendenhorst dieser Aufforderung Folge geleistet und die Sparkasse aus der Taufe gehoben wurde. In den Gründungstatuten legte man fest, dassneben dem wichtigsten Aufsichtsorgan, dem sog. Curatorium
(Direktor, 4 Beisitzer, 4 Stellvertreter), ein geschäftsführender Rendant eingesetzt wird, der zwar eine bestimmte Kaution stellen und damit selbst über ein angemessenesVermögen verfügen musste, der
aberauch mit 30 % des Zinsüberschusses besoldet werden sollte. Bei guter wirtschaftlicher Entwicklung durchaus ein lohnendes Geschäft. Hauptmann Heinrich Brüning, Mitglied des Provinziallandtages,
stellte sich für diesen Posten zur Verfügung. Er war ein angesehener und bekannter Mann, der auf dem Grundstück Weststraße 13 neben der Landwirtschaft auch eine große Brennerei betrieb. Ein„Brenner“
also als erster Rendant der Sparkasse, der nun in seinem reprä- sentativen Ackerbürgerhaus ein Sparkassen-Kontor einrichtete. Damit wurde eine 57 Jahre währende Ära einge- läutet, in der drei
aufeinander folgende Mitglieder der Brennereifamilie Brüning/Rötering als Geschäftsführer das „Schiff Sparkasse“ sicher und erfolgreich durch alle Höhen und Tiefen manö- vrierten. 14 Jahre lang
leistete Hauptmann Heinrich Brüning die eigentliche Aufbauarbeit. Obwohl er nicht auf eingefahrene Wege und Erfahrungen von Vorgängern zurückgreifen konnte, tat er das offenbar zu aller
Zufriedenheit. Als er 1880 starb, ging das Amt an seinen Stiefbruder Reinhold über, der es bereits vier Jahre später an seinen Schwiegersohn, Bernhard Rötering, übergab.
Abb.114: Porträt Heinrich Brüning
Als dritter Rendant führte er die Geschäfte 39 lange Jahre (!), zunächst allein und spä- ter mit einem Gegenbuchführer und mehreren Angestellten. In seine lange Amtszeit fielen u.a. die Umstellung
der Sparkassengeschäfte entsprechend der veränderten Gesetzgebung nach Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches am 1.1.1900, der Umzug derSparkasse aus dembeengten Kassenraum in der Weststraße in
Räumlichkeiten des 1911 neu erbauten Rathauses sowie die Bewältigung der schwierigen Bedingungen im Ersten Weltkrieg, der Zeit danach und schließlich der Inflation. 1923 übergab Bernhard Rötering
sein Amt an seinen lang- jährigen Gegenbuchführer Heinrich Dorsel. Für sein langes, erfolgreiches Wirken wurde er am 9. März 1921 mit dem Titel „Direktor“ und einerrückwir-
Abb.115:Porträt Bernhard Rötering
Abb.116: Luftbild Rathaus mit Neubau Sparkasse
kenden Gehaltserhöhung geehrt. Aber auch in den Vorständen und Aufsichtsorganen der Sparkasse finden sich weitere Brennerpersönlichkeiten. So wurden die Brennereibesitzer Vrede (Kirchspiel) und
Ridder (später Hotel Herweg) bereits in der Anfangszeit, der Gemeindevorsteher Gerhard Werring etwas später, alsBeisitzer bzw. Stellvertreter im wichtigsten Organ der Sparkasse,dem „Curatorium“
bestimmt,dessen Direktor ab 1887 der Bürgermeister und Brennereibesitzer Panning war.
Abb.117: Porträt Brennereibesitzer Vrede – Mitglied im Curatorium der Sparkasse
In der sog. Deputation zur Controlle der Ge- schäftsführung saß der Holzhändler Tawiede, der in direkter Nachbarschaft des Rendanten Brüning auf der Weststraße lebte und dessen späterer Schwiegersohn
Josef Arens, gen. Sommersell, auf diesem Grundstück 1882 eine Brennerei gründete.
Abb.118:Nachruf Gerhard Werring – Mitglied im Curatorium der Sparkasse
Abb.119: Sparkassenvorstand und –rat 1967 mit dem Brenner Carl Werring
Als im Jahre 1958 im Zuge eines neuen Sparkassen- gesetzes das frühere Kura- torium durch einen Spar- kassenrat ersetzt wurde, waren ab 1966 wiederum zwei bekannte Brennerei- besitzer tätig – Carl
Werring und Josef Horstmann.
Zur Geschichte der Volksbank
Ein weiteres Geldinstitut – der sog. Spar- und Darlehenskassenverein - wurde am Ende des 19. Jahrhunderts, am 7. Februar 1897, gegründet. Später sollte sich aus diesem Verein die Spar- und
Darlehenskasse bzw.Volksbank entwickeln.
Auf der Grundlage der genossenschaftlichen Selbsthilfe, die bereits 1866 durch Friedrich WilhelmRaiffeisen als „Mittel zur Abhilfe der Noth ländlicherBevölkerung sowie auch der städtischen Handwerker
und Arbeiter“ erkannt worden war, schlossen sich Sendenhorster Landwirte, Brenner, Handwerker und Gewerbetreibende zusam- men, um eine „fruchtbringende Hilfsgemeinschaft“ – eine eingetragene
Genossenschaft mit unbe- schränkter Haftung – zu grün- den. Unter dem Motto „Einer für alle, alle für einen“ sollten diejenigen, die über ausrei- chend Geld verfügten, es denje- nigen zur Verfügung
stellen, die es benötigten. Mit Darlehen, die durch den genossenschaft- lich geführten Verein kontrol- liert vergeben wurden, wollte man die wirtschaftlich Schwachen fördern und vor dubiosen privaten
Geldverlei- hern schützen. So wird in der Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum der Spar- und Darlehenskasse betont, dass von den ersten Anfängen an weni- ger die Spareinlagen, als der Erhalt und die
Förderung der heimischen Wirtschaft, des Wohnungsbaus und der gewerblichen Betriebe im Vordergrund standen.
Abb.120: Volksbankmotto „Bring us dien Geld, legg’t nich in Pott…“
Im Gegensatz zu dem Grundverständnis der Sparkassen, die bis zu ihrer Loslösung im Jahre 1958 in Abhängigkeit von den Gewährsgemeinden agierten, spielten bei der Entstehung der Spar- und
Darlehenskassenvereine die Begriffe Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung eine wichtige Rolle. Dennoch wurden auch die Geschäfte des neu gegründeten Spar- und Darlehenskassenvereins
durch einen Geschäftsführer, den Rendanten Düning, geführt, der jedoch nicht dem Kreis der Brennereibesitzer angehörte. Neben seiner Tätigkeit war für die erfolg- reiche EntwicklungderVolksbank vor
allem auch das Interesse der Mitglieder, die jähr- lichmit einer Dividende am Erfolgbeteiligt wurden, sowie die genossenschaftlichen, gemeinsamen Entscheidungen und Kon- trollmechanismen von
Bedeutung.
Abb.121: Haus Düning (heute Mettler/Schwermann)
– erste Geschäftsstelle der Spar- und Darlehenskasse
Es ist bezeichnend für das wirtschaftliche Denken der Sendenhorster Brenner, dass wiederum viele von ihnen aktiv in die Gründung und weitere Entwicklung dieser genossenschaftlichen Einrichtung einge-
bunden waren, wobei im Hinblick auf die Übernahme von Ämtern offenbar das ehrenamtliche Engagement im Vordergrund stand. So fand die erste konstituierende Generalversammlung des Senden- horster
Spar-Darlehens-Kassen- vereins am 2. Mai 1897 „imHause des [Brennerei- und Brauerei- besitzers] Wieler Theodor“ am Kirchplatz statt, das heute Räumlichkeiten der Volksbank beherbergt, und der
Branntwein- brenner Josef Arens, gen. Sommersell wird die folgenden vier Jahre, von 1897-1901, als Mitglied des Vorstandes tätigsein. In den Aufsichtsrat gewählt wur- den in dieser ersten Sitzung die
Brenner Theodor Wieler (1897- 1907) und Heinrich Meyer (1897-1899).
Abb. 122: Einladung zur ersten Generalversammlung im Hause des Brennereibesitzers Theodor Wieler (heute Haus Plüschke)
Aber auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmten Sendenhorster Brennereibesitzer die Geschicke der Spar- und Darlehenskasse bzw. der späteren Volksbank mit.
Abb.126: Beirat der Spar- und Darlehenskasse (Datum? Namen?)
Abb.123: Josef Arens, gen. Sommersell
– von 1897-1901 Mitglied des Vorstandes der Volksbank
Abb. 124: Theodor Telges-Homann
von 1905-1909 Mitglied des Aufsichtsrates der Volksbank
Abb.125: Karl Zurmühlen/Werring von 1928-1942 im Aufsichtsrat, von 1942-1945 Vorstandsvor- sitzender der Volksbank
So wird Herman Werring, der zur damaligen Zeit eine Brennerei an der Südstraße betrieb, von 1905-1911 als Mitglied desVorstandes erwähnt, und der Bauer und Brenner Theodor Telges-Homann aus dem
Kirchspiel war von 1905-1909 im Aufsichtsrat tätig. Von 1928-1942 gehörte diesem Gremium auch Karl Zurmühlen/ Werring an, bevor er für drei Jahre (1942-1945) das Amt des Vorstandsvorsitzenden
übernahm.
Die Kornbrenner als Arbeitgeber
Die bauliche, technische und wirtschaftliche Entwicklung der Sendenhorster Brennereibetriebe wurde in Kapitel I ausführlich beschrieben. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Brennerei- und
Wirtschaftsgebäude immer wieder den wechselnden Rahmenbedingungen und Erfordernissen angeglichen, vergrößert und modernisiert. Dank der Tatsache, dass einige der untersuchten Familienarchive bis
heute für alle durchgeführten Bautätigkeiten neben dem allgemeinen Schriftverkehr mit Handwerkern und Zulieferfirmen Kostenvoranschläge, Material- und Lohnkostenabrechnungen besitzen, wissen wir,
dass für größere und kleinere Bauvorhaben wenn irgend möglich heimische Handwerker und Firmen – Architekten und Baufirmen, Maurer,Tischler, Schreiner,Fliesenleger und Maler – beauftragt wur- den.
Dagegen wandte man sich im Hinblick auf die technische Ausstattung der Brennereien teilweise an weit entfernte Spezialfirmen.
Zudem beschäftigten zumindest die größeren Brennereibesitzer in der Regel eine stattliche Zahl landwirtschaftliches und häusliches Personal.Wie das Leben in so einem Haushalt organisiert war, darüber
berichtet Senta Fronholt in ihren Erinnerungen an die FamilieEverke.
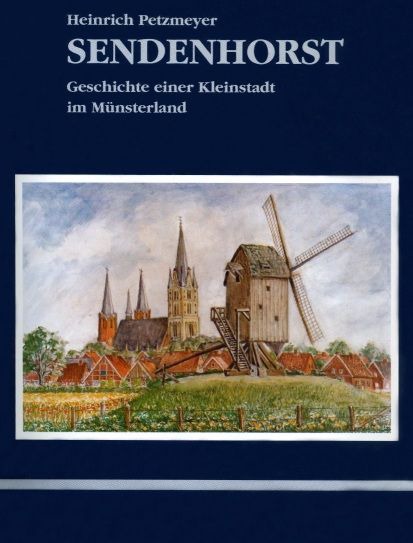 Als
Köchin bei der Brennerfamilie Everke
Als
Köchin bei der Brennerfamilie Everke
(Senta Fronholt)
Es muss etwa im Jahr 1950 gewesen sein, als ich eine Blinddarmoperation hatte und mehrere Wochen nicht arbeiten konnte. Meine damalige Arbeitgeberin hatte mir des- halb gekündigt. Ich habe dann
regelmäßig im Arbeitsamt nachgefragt, ob man mir eine andere Stelle als Haushilfe anbieten könnte. Über Wochen bekam ich immer dieselbe Antwort: „Der Brennereibesitzer Everke in Sendenhorst sucht für
seinen großen Haushalt (dem immerhin 17 Personen angehörten) dringend eine neue Köchin!“ Da ich noch in Fellhammer Weißnäherin gelernt hatte und vom Kochen nur das Nötigste verstand, kam diese Stelle
für mich zunächst einmal gar nicht in Frage. Da sich aber nun gar nichts anderes fand, habe ich mich schließlich überreden lassen, wenigstens einmal bei Everkes vorzusprechen. Und die junge Frau
Everke meinte: „Wissen Sie was, wir probieren das!“ Also habe ich gelernt, jeden Tag für 17 Personen zu kochen.
Da waren die Großmutter („Omi“) Everke, die jungen Eltern Heinrich und Erika Everke und ihre 7 Kinder, eine pensionierte Privatlehrerin, die den Kindern bei den Schularbeiten half, ein Kindermädchen
und ein Hausmädchen, das den ganzen Tag nichts anders tat als zu putzen, ein Brenner, ein Schweizer-Ehepaar und ich als Köchin. Ich erinnere mich noch an das Kartoffelpufferbacken für so viele
Menschen! Da gab es keine Maschinen! Und Nikolaus wurden Plätzchen gebacken. Milchkannen voll! Selbst Marzipan haben wir selbst hergestellt.Wenn Nikolaus gewesen war, dann waren die „Pötte“natürlich
wieder leer und man fing von vorne an. Jeder bekam einen Teller, auch wir Mädchen. Die junge Frau Everke, sie hatte alles im Griff. Immer trug sie eine Tasche am Arm, in der sie einen Stift und ein
Notizheft hatte, um aufzuschreiben, was nötig war. Meist kaufte sie selber ein. Nur am Freitag ging ich zur Molkerei. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Butter und Käse ich dort geholt habe! Unmengen!
Sonst war eigentlich alles vorhanden. Everkes hatten ja einen großen Gemüsegarten, in dem auch ein Hühnerstall stand. Er lag stadtauswärts am Ende der Neustraße auf der linken Seite. Morgens machte
ich das Frühstück fertig. Ich erinnere mich, dass die Butter immer verziert werden musste. Wenn ich keine Zeit hatte, habe ich manchmal nur mit der Gabel reingepickt. Mittags gab es für alle
reichlich und gut zu essen. Vorne im Speisezimmer aßen die Eltern, die Kinder, das Kindermäd- chen und die Lehrerin; in der Küche das Stuben- mädchen, der Brenner und ich. Das Schweizer-Ehe- paar
nahm sein Essen mit auf die Kammer. Das Fleisch wurde immer erst in das Speisezimmer ge- bracht, wo der Hausherr es teilte. Dann wurde ge- schellt und Margot, das Hausmädchen, ging und holte unseren
Anteil. Natürlich mussten auch die Männer auf dem Feld und beim Dreschen in der Feldscheune versorgt wer-
Abb.127: Haus Everke heute
Abb.128: Senta Fronholt mit ihrem Mann Josef Fronholt
den. Eines Tages sollte ich Kartoffelbrei und Sauerkraut mit durchwachsenem Speck zur Feldscheune bringen – und zwar mit Pferd und Wagen! Ich hatte doch noch nie ein Pferd gelenkt, aber Frau Everke
meinte: „Das geht schon! Das können sie alle!“ Pferd und Wagen standen schon angespannt vor Everkes Stall auf der Neustraße. Autos fuhren ja damals noch nicht. Ich bin also auf den Wagen gestiegen
und gleich beim Anfahren habe ich schon fast die Hausecke mitgenommen. Ich war froh, dass ich keine Erbsensuppe auf dem Wagen hatte, die es normalerweise gab. Das Pferd ist dann brav mit mir bis zum
Feldweg und weiter zur Feldscheune gelau- fen. Es wusste genau Bescheid. Als „wir“ vorfuhren, kamen die Männer aus der Scheune und freuten sich, dass es dieses Mal keine Erbsensuppe gab. Auch auf dem
Rückweg hat mich das Pferd nicht ent- täuscht. Es lief anstandslos und ohne mein Zutun in Richtung Stadt zurück zum Stall. Der Brenner arbeitete nur in der Brennerei. Er war ein junger Bursche und
hieß Paul Mohrfeld, der über der Tenne in einem Zimmer mit eigenem Badezimmer wohnte. Übrigens haben alle Angestellten mit der Familie in dem großen Haus gewohnt. Mit der Brennereihatte ich
eigentlich weniger zu tun. Auf dem Kessel oben haben wir die Wäsche getrocknet. Manchmal haben wir auch geholfen, die Flaschen abzufüllen.Wir saßen dann alle im Kreis in dem großen Flur und jeder
übernahm eine andere Aufgabe. Erst wurden die Flaschen mit einer Korkmaschine zugekorkt, was immer einen Ruck und ein komisches Geräusch verursachte. Danach mussten über die Korken und Flaschenhälse
Gummihäute gezogen werden, die vorher in Wasser gelegt wurden, um sie geschmeidiger zu machen. ZumSchluss wurden die Flaschen mit Etiketten beklebt, abgeputzt und in Kästen verstaut. Über die
Doppelkornflasche wurde übrigens ein Bastgeflecht gezogen, das verknotet werden musste.
Abb.129: Senta Fronholt mit Kindern im Garten
Eines Tages gab mir Herr Everke den Auftrag, Flaschen mit Wacholder abzufüllen. Dafür musste man mit einem fingerdicken Schlauch, der in einem Fass steckte, den Wacholderschnaps so lange „ansaugen“,
bis er von alleine lief. Dann hielt man eine leere Flasche darunter und wenn sie voll war, drückte man einfach den Schlauch zu und nahm die nächste. Herr Everke hatte mich für diese Aufgabe
ausgesucht, weil der- jenige, der das bis dahin gemacht hatte, weniger die Flaschen, als sich selber abgefüllt hatte! Da ich an Alkohol überhaupt nicht gewöhnt war, konnte er bei mir sicher sein,
dass das nicht passierte.
Brennereihaushalte und Gaststätten – Erinnerungen Sendenhorster Bürger
Um auch die Wahrnehmung der „Brenner“ durch die Sendenhorster Bevölkerung zu berücksichtigen, rief der Arbeitskreis Stadtgeschichte in der Zeitung dazu auf, für den Begleitband Erinnerungen „rund um
den Sendenhorster Korn“ zu verfassen. Die fol- genden Aufzeichnungen gehören dazu.
Die Gastwirtschaft und frühere Brennerei Suermann
(von Marianne Werring)
Seit Jahrhunderten führen Straßen aus allen vier Himmelsrichtungen in das Ortszentrum von Sendenhorst. Dort, wo diese Straßen in den Ortskern einmünden, befanden sich sog. Ausspannstätten. Hier
konnten die in die Stadt kommenden Bauern ihre ausgespannten Pferde in Boxen unterstellen und in aller Ruhe ihren Geschäften nachgehen. Die Kutschen blieben solange auf der Straße stehen.
Abb.130: Die Ausspannstätte Gaststätte Peiler (Bild Bernd Höne)
Jeden Sonntag fuhr unsere ganze Familie – meine Eltern, meine Tante Christine und wir sechs Kinder (zwei eigene, drei Cousinen und ein Vetter) - zur 8.00 Uhr Messe. Wir hatten einen größeren
Jagdwagen. Drei Personen saßen auf dem Rücksitz, vier Kinder auf dem Sitz gegenüber, zwei Kinder zusammen mit dem Kutscher auf dem Bock. Der Wagen war im Sommer offen; im Winter wurden Seitenteile
und ein Verdeck mit “Druckknöpfen” befestigt. Oft fuhren wir auch zweispännig. Angespannt wurden die Pferde, die für die Sämaschine und leichtere Arbeiten gebraucht wurden. MeinVater legte großen
Wert auf gutes, gepflegtes Pferdegeschirr und gesäuberte Hufe. Mutter sorgte für die Sauberkeit der Laternen, in denen Wachskerzen brannten. Für
Abb.131: Gasthof Suermann am Kirchplatz (heute Ärztehaus neben Apotheke)
den Winter besaßen wir extra warme Kutschwagendecken und eine kupferne Wärme- flasche für die Füße. Wir spannten die Pferde grundsätzlich beim Gasthaus Suermann aus. Unsere jungen Eleven (Lehrlinge)
waren für das Ausspannen zuständig. Die Pferde wurden im Stall angebunden, mit Heu oder Stroh gefüttert und mit Wasser getränkt. Die Decken nahmen wir mit ins Gasthaus, wo sie für die Rückfahrt
aufgewärmt wurden. Jede Familie hatte in der Kirche ihren bestimmten Platz, ihre Bank. Da streng auf die Einhaltung des„Nüchternheitsgebotes“ geachtet wurde, freuten wir uns alle nach der hei- ligen
Messe auf eine Tasse “Mukefuk” und Zwieback, die uns bei Suermann erwarteten. Und wenn es kalt war, bekamen wir Boullionsuppe und Brötchen. Die Geschäfte waren damals sonntags geöffnet. Man kaufte
bei Zimmermann-Lüke Lebens- mittel wie Zucker, Rosinen, Haferflocken und Hefe ein, bei Familie Holtel Textilien. Mit der Familie Holtel waren meine Eltern und Tante Christine sehr befreundet. An
Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Maria Himmelfahrt gab es ein extra Essen bei Holtels.
Abb. 132: Werbung Suermann Als wir Kinder größer waren, machten wir uns schon oft zu Fuß auf den Weg nach Hause. Die Gaststube im Erdgeschoss befand sich auf der rechten Seite des Hauses. Beim
Betreten des Gasthauses hatte man den Eindruck, in einer großen Kochküche zu sein. Rechts befand sich eine kleine Theke mit einer mit Wasser gefüllten emaillierten Schüssel, die als Spülbecken für
die Gläser benutzt wurde. Fließendes Wasser gab es nicht. Drei kleine Tische waren im Raum verteilt. In der linken Ecke stand der Kochherd, der den Raum wärmte und zugleich zum Kochen der Speisen
diente. Rechts vom Hauptraum lag einGästezimmer, in dem zwei längere Tische mit Stühlen standen und in dem unsere Familie gewöhnlich saß. Dieser Raum wurde durch einen gusseisernen Ofen erwärmt, der
auch das Nebenzimmer heizte und von dort aus
Abb.133: Hochzeitszug vor der Gaststätte Suermann befeuert wurde. In diesem Nebenzimmer, das nur über ein Fenster verfügte und sehr dunkel war, befanden sich ein Sofa, ein Tisch, ein kleiner Sessel
und einige Stühle. Hier aßen die beiden Wirtinnen, die wir Tante Trudi und Tante Fine nannten. Oft durften wir bei ihnen mit essen.Vom Hauptraum aus führte die Treppe zum Schlafraum der beiden
Wirtsleute, zu den oberen Zimmern und zum sog. Saal, wo der Kirchenchor Cäcilia tagte. Alle Räume waren nicht beheizbar.Tante Trudi und Tante Fine schliefen in einem „eineinhalbschläfrigem“ Bett, das
frei in dem großen Raum stand. Ich erin-
Abb.134: Grundriss des gesamten Anwesens Suermann. Räume 1-3 waren die Gasträume. nere mich, dass der Raum mit schönen alten Schränken, einer Spiegelkommode und einem Wäscheständer möbliert war. Da
die beiden Frauen Asthma hatten, saßen sie mehr im Bett, als dass sie lagen. Mit guter Leinenwäsche waren die Betten bezogen; der Ausdruck “wie kourmt houch her” wurde oft betont. Ihre Mutter kam von
dem großen Hof Roxel aus Beckum.Trudi Suermann fiel durch ihren Wortschwall auf, sie “schanduldelte”, ich verstand vieles nicht. Aber eines wusste ich - es war die Partei und die dazugehörigen Leute,
die sie be-schimpfte. Ein 87jäh- riger Mann erzählte mir, wenn jedes Wort ernst genommen worden wäre, hätte das Leben der Frauen im KZ geendet. Sie hielten ihren “Schnabel” nicht.Viele Dinge habe ich
in Erinnerung.Trudi Suermann verschönerte ihre Haare mit der Brennschere.Von meiner Mutter kannte ich soetwas nicht. Die drehbare Eisenlockenschere wurde in die Feuerung des Kochherdes erhitzt. Nach
einiger Zeit, als sie fast glühend war, wurde an
Abb.135: Totenzettel von Gertrud Suermann (1888-1959)
einem Zeitungspapier geprüft, ob sie zu heiß oder passend war. Ich habe das Geklappere der Schere noch in meinen Ohren. Zum Abkühlen wurde sie so lange gedreht, bis die richtige Temperatur erreicht
war. Dann wurde die Lockenschere in den Haarschopf gedrückt. Heute glaube ich, dass viele Haare dabei angesengt wurden. Trudis hatte in ihrem Unterkleid, einem festen Unterrock, eine besondere
Tasche. Hier griff sie rein um Geld zu wechseln, Schlüssel zu suchen und vielleicht auch ein Taschentuch aufzuheben. Fine Suermann hielt sich mehr im hinteren Bereich des Hauses, auf der Tenne und in
den Stallungen, auf. Sie war für das Melken der drei Kühe zuständig; sie drehte mit der Hand die Rübenschneidemaschine und sorgte für die Sauberkeit im landwirtschaftlichen Bereich. Da zu der
Gaststätte früher eine Bäckerei und eine Brennerei gehörten, waren die Räumlichkeiten dementsprechend groß. Mit dem Tod von Gertrud (Trudi) Suermann im Jahre 1959 verschwand der Name aus Sendenhorst,
was in der Todesanzeige mit dem Ausdruck “der Name geht von uns fort” deutlich gemacht wurde.
Anmerkung zur Gaststätte Suermann
(Dieter Obermeyer)
Es war üblich, dass die jungen Männer, die Soldat werden sollten, sich bei Suermanns vor der Musterung trafen. Dort wurden die Lieder eingeübt, die wir dann gesungen haben:“Nach Beckum marschieren
wir; da werden wir physentiert; ob wir tauglich, ob wirbrauchbar, ob wir brauchbar sind zum Dienst. Juffi Fallerallala! Grüß das Mädchen noch einmal; ob wir brauchbar sind zum Dienst.“ Der Text
„Unser Kaiser Wilhelm hat selber gesagt, dass junge Leute müssen werden Soldat“ wurde umgedichtet in „Unser Führer Adolf Hitler hat das selber gesagt…“ Und kurz vor der Einberufung gab es noch einen
Marsch durch Sendenhorst, der stets am Kriegerdenkmal endete. Es gab auch ein Lied über den „Öhm an der Muer“, der in der Regel der Zweitgeborene war und den Hof nicht erben konnte. Er hatte aber ein
Wohnrecht auf Lebenszeit. In vielen Fällen hat er an der Mauer gesessen, das Herdfeuer vor sich.
Die Gaststätte Kaupmann
(Bernhard Münstermann)
Die Gaststätte Kaupmann (früher Hotel Klümper, heute Bürgerhaus) an der Weststraße war für viele Sendenhorster Bürger und Vereine eine wichtige Anlaufstelle.
Abb.136: Hotel Klümper/später Hotel und Gaststätte Kaupmann
So betrachteten z.B. der Kirchenchor und der Kolpingverein diese Gaststätte als ihr Stammlokal. Auch einige Brenner – u.a. die Herren Horstmann, Werring und Sommersell – trafen sich hier nach 1946
regelmäßig am Sonntag nach der Kirche, wobei man anschließend oft noch die Gaststätte Herweg besuchte. „Vatti Kaupmann“ kam aus Harsewinkel/Marienfeld. Er war Gutsverwalter beim Baron von
Nagel/Ostenfelde gewesen. Seine Frau war gebürtige Wadersloherin. In den 20er Jahren kauften sie das damalige Hotel Hullerum (davor Klümper). Kaupmanns konnten gut mit den Gästen umgehen; beide waren
sehr leutselig.
Abb.138: Sitzecke bei Kaupmann
Abb.137: Gaststätte Kaupmann kurz vor dem Abriss
Die Gaststätte war sehr gemütlich eingerichtet – wie eine richtig alte Münsterländer Kneipe. Über dem Tresen standen die Worte: „Das Trinken lernt der Mensch zuerst, viel später dann das Essen; drum
soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen“.
Abb.139: Theke mit dem Wirtsehepaar Kaupmann
Wenn man in die Gaststube kam, stand links eine sehr schöne alte Bank – sie steht heute noch bei Schlautmann – ähnlich einem Chorgestühl. Davor stand einTisch, an dembequem acht Leute sitzen konnten.
Jeden Sonntag saßen hier die gleichen Bauern. DieBrenner tra- fen sich hier zwar auch regelmäßig, sie hielten sich aber wohl mehr an der Theke auf. Das Schützenfest fand einige Male bei Kaupmann im
Saal und in einem Zelt vor der Kneipe in der Westraße statt, die dann völlig gesperrt wurde. Den Schnaps bezog er dann von den benachbarten und verbundenen Brennereien Sommersell,Werring und
vielleicht auch noch einer dritten Brennerei. Bevor das Schützenfest auf dem Lambertiplatz statt- fand, hatte man es an ganz unterschiedlichen Plätzen durchgeführt – auf dem Marktplatz vor dem
Rathaus, in der Gaststätte Werring (heute DRK), auf Geipings Wiese, bei Sommersells Mühle (heute Körkemeyer) und in der Fabrik Bleckmann.
Abb.141: Werbung der Gaststätte Kaupmann
.
Die Brennereien im Osten der Sendenhorster Altstadt und der Hof Horstmann
(Dieter Obermeyer) Bei meinem täglichen Gang in den Ort bekam ich immer dann, wenn ich die S- Kurve, an welcher das Textilgeschäft von I.B. Holtel lag, passiert hatte, einen Duft in die Nase, der den
Brennereien von Silling und Vissing in der Oststraße entstammte. Sillings Brennerei schien damals unbedeutend, dafür wurde aber die ebenfalls betrie- bene Kneipe offenbar gut besucht. Warum man den
damaligen Betreiber „Graf Heseler“ nannte, weiß ich nicht, sehe ihn indessen in meiner Erinnerung vor einer Fuhre mit aufgeladenem Mist, die Peitsche geschultert, einen uralten Hut auf dem Kopf, die
Füße in ausgetretenen, stabilen Schuhen steckend, über denen er die Waden mit Ledergama- schen bedeckt hielt.
Ein völlig anderes Bild bot dagegen die Brennerei Lainck- Vissing auf der anderen Seite der Oststraße.
Abb.142: Wohnhaus und Brennerei Lainck-Vissing vor der Sanierung
Von der Straße aus konnte man durch ein Fenster ebenso wie durch die meist geöffnete Türe in das Hochparterre des Raumes hineinsehen, in wel- chem „gebrannt“ wurde. Ich erinnere mich deutlich an
etli- che große Kupferkessel und immer sehr blank geputzte zugehörige Hauben oder Deckel. Lebendes Aushänge- schild indessen war Heinrich Vissing selbst. Er trug meistens eine graue Mütze, grüne
Lodenkleidung, die ihn auch als Jäger mit eigener Jagd ausweisen sollte und an den Füßen die unvermeidlichen Holzschuhe. Diese wurden für ihn vom Holzschuhmacher Börger eigens aus besonders leichtem,
dennochstrapazierfähigem Holz gefertigt. So angetan stand er häufig auf der, wie erwähnt,
Abb.143: Brennerei Vissing
während des Abbruchs des Hauses Northoff erhöhten Türschwelle zur Oststraße, gut darauf achtend, dass er mit Blicken alles wahrnahm, was ihm wichtig erschien, gerne auch in ein Gespräch eingreifend,
wenn es ihm passte. Zu seinen Füßen floss derweil meist warmes Wasser aus seiner Brennerei in die Gosse vor dem Hause und von dort an drei Häusern vorbei in einen Abfluss vor dem Gasthaus
Peiler-Selige. Die beschriebenen Holzschuhe wurden übri- gens nach Vissings Tode von seiner Witwe Elise sorgfältig aufbewahrt in der Diele des schönen, alten Hauses, wo es eine Menge wertvoller,
antiker Möbel und Einrichtungsgegenstände gab. Kam ich – selten einmal – aufgestiegen von der Straße über mehrere Treppenstufen in diesen Raum, empfand ich dort sogleich eine andere, vornehmere und
anscheinend reichere Welt, als ich sie von zu Hause aus kannte. Irgendwie
Abb.144: Porträt Heinrich Lainck-Vissing in Jagdkleidung
Abb. 145: Diele und Gastraum Lainck-Vissing
machte mir der offensichtlich traditionell gewachsene Besitz und das Flair eines nobel- rustikal eingerichteten Raumes deutlich Eindruck. Am großen Herdfeuer, das an der rückwärtigen Wand installiert
war, hingen Utensilien wie Feuerhaken, Kupferkessel und eine Reihe von blank polierten Messingsachen. Lisbeth Steiling hantierte in der dahinter liegenden Küche mit Töpfen und Pfannen.Als sie das
Dingding der Türglocke gehört hatte, verursacht durch meinen Eintritt, steckte sie den Kopf aus der Tür und sagte: „ Kiek äs, dat is jä Diete!“ Mein Vater hatte ein paar Jahre lang ein Zimmer im
Vissingschen Hause gehabt und kannte natürlich alle, die hier ein- und ausgingen, recht gut. Sonntagmorgens versam- melten sich fast ausschließlich Bauern um das Herdfeuer. Heinrich Vissing hatte für
den Ausschank seines eigenen Produktes auch eine ausdrückliche Lizenz. Sie verbot es ihm allerdings, nach 22 Uhr noch Alkohol auszuschenken und das führte – so berichtete meinVater – zu einer Klage
vor dem Amtsgericht in Ahlen, ausgelöst wahr- scheinlich von einem missgünstigen Bürger.Vissing hatte sich einen Anwalt genom- men und zu den geladenen Zeugen gehörte auch mein Vater. „Nichts
bestellt und nichts bezahlt“ sollen alle Zeugen immer wieder übereinstimmend gesagt haben, so dass die Klagen mangels Beweisen abgewiesen wurde. Einer der beteiligten Bauern soll geäußert haben:
„Segg mim en Bescheid, Heinrich, wenn Du’t naichste Moal wier Diene private Inladung häs, daomet ick mi denn auk beteiligen kann. Umsüß süpt sick’s jä biäter!“
Erinnerung an den Hof Horstmann
Gerne erinnere ich mich auch an den Hof Horstmann. Bitte gehen Sie einmal im Geiste mit mir in mein Elternhaus, das damals demViehhändler Siekmann gehörte und hinter dem Kriegerdenkmal stand und noch
heute steht. Vom Fenster meines Schlafzimmerchens – es war in der Dachspitze gelegen – hatte ich einen freien Blick nicht nur zum Nachbarhaus Geilern, sondern auch über die gesamte Landschaft hin-
weg bis zum Hof Horstmann, zu dem sich ein Weg schlängelte.
Abb.146: Alter Hof Horstmann mit kleinem Fachwerk-Brennereigebäude
Die Familie Horstmann war meinen Eltern und mir sehr gut bekannt. Meine Mutter, mein Bruder Jobst und Verwandte aus Wuppertal, die bei uns untergekommen waren, wurden bei Kriegsende, als
amerikanische Soldaten unser Wohnhaus besetzten, bei Horstmannsaufgenommen. Alle haben sie damals in dem Horstmannschen Wohnhaus gewohnt. Ich war bis 1948 in amerikanischer Gefangenschaft in den USA
und später in Frankreich. Als ich zurückkehrte, lebte meine Familie schon wieder in unserem Wohnhaus, in dem ich dann auch noch ein Jahr verbrachte, bevor ich eine Kaufmannlehre absolvierte. Meine
Kindheit ist eindeutig mit der Familie des Landwirts und Brenners Peter Horstmann verbunden. Zum einen, weil auf Spaziergängen immer wieder auf dem Hof eingekehrt wurde; zum anderen, weil die jüngste
Tochter Irmgard, genannt Dole, mit mir die Rektoratsschule besuchte. Sie war die Schwester von Josef – Jopp - Horstmann, der sich immer schon mit hoher Intensität für kaufmännische Dinge
beschäftigte, diejedoch nie am Schreibtisch stattfanden sondern immer in Gesprächen. Die Brennerei spielte in meiner Kindheit so gut wie kaum eine Rolle. Sie war winzig und in einem Nebengebäude des
Hofes untergebracht. Ich sehe mich heute noch durch die kleine Tür gehen. Jopp stand an dem großen Apparat und den Behältern aus Kupfer. Für mich war der Horstmannsche Hof aber weniger im Hinblick
auf die kleine Brennerei interessant, als vielmehr die Gräfte, die sich, gespeist von den Abwässern der Brennerei, um den Hof herumzog. Wenn sie im Winter zugefroren war, konnte man dort
Schlittschuhlaufen.Als wir einmal auf dem Eis waren, kam Dole mit einem Tablett voll „Bütterkes“ angefahren. Nun hatte mir meine Mutter aufgegeben, unter keinen Umständen bei anderen Leuten zu essen
oder Essen anzunehmen. Die „Bütterkes“ lockten mich natürlich unheimlich, ich lehnte aber schweren Herzens ab. Und Dole? Sie machte kehrt und fuhr zum nächsten. Ich hatte „nein“ gesagt und
fertig.
Sendenhorster Brenner aus dem Blickwinkel eines Kindes
(Bernd Höne)
In meiner Kindheit hatte ich eine ganz besondere Beziehung zu der Gastwirtschaft und Brennerei Silling an der Oststraße, die auch „Osten-Silling“ genannt wurde. Zum einen gehörte es zu meinen
regelmäßigen Aufgaben, für meinen Opa in dem SilllingschenGasthof Korn zu holen, der aus einem Fass im Keller zur Theke gepumpt und dort mittels eines Hahnes in den mitgebrachten Flachmann gefüllt
wurde. Wenn ich den Gastraum betrat, kam Josef Silling aus den hinteren Räumen nach vorne. Er sprach wenig, bedienteseine Gäste verbindlich aber nicht überschwänglich und er hielt den Kopf immer ein
wenig schräg. Er war ein bescheidener und ruhiger Mann, der sich mit seiner großen Familie – Sillings hatten mindesten 5 Kinder - alle Mühe gab, die kleine Landwirtschaft, denGasthof und die
Brennerei aufrecht zu erhalten. Mit im Haus lebte auch ein unverheirateter Bruder, ein „Öhm“, der nicht so gerade gewach- sen war wie andere. Oft stand er im Gastraum an der Seite, bediente wohl auch
manch- mal in Notfällen, ohne aber eine wirkliche Aufgabe zu haben. Aber auch die Rückseite des Sillingschen Betriebes war mir wohlbekannt.Wenn in der Winterzeit das Futter für unsere Kühe knapp
wurde, schickten mich meine Eltern mit einem Bollerwagen und zwei alten Milchkannen zu Silling, um Schlempe zu holen. Im Hof stand eine Pumpe, mit der das begehr- te Viehfutter aus einem
unterirdischen Bunker nach oben in meine beiden großen Milchkan- nen befördert werden konnte. Die Bezahlung erfolgte in der Regel am nächsten Sonntag- morgen durch meinen Vater nach dem Kirchgang.
Der Kirchgang und der Besuch der Gaststätten – das gehörte einfach zusammen. Das führte dazu, dass nach der Messe alle Gaststätten brechend voll waren. Mein Vater ging immer zu Silling oder – gleich
gegenüber – zu Peiler.
Abb.147: Porträt Heinrich Lainck-Vissing
Nur ein paar Meter weiter Richtung Kirche lag die Gastwirtschaft und Brennerei Lainck- Vissing (heute Börse). In grüner Lodenklei- dung, grünen Kniestrümpfe, braunen Lederschuhe oder Holzklotzen
stand Herr Lainck-Vissing an dem heute nicht mehr exi-
Abb.148: Ehepaar Lainck-Vissing im Hof des Grundstücks.
Auf der Wand über der Sitzecke ist zu lesen: “Was Du ererbt von den Vätern, erarbeite es, um es zu besitzen.“ stierenden Brennereieingang an der Oststraße, wo die Fässer herausgerollt wurden oder
auch Material angeliefert wurde. Immer hatte er die Daumen in der Weste stek- ken und er schaute nach links und rechts, was sich so auf der Straße tat Frau Lainck-Vissing war immer sehr gepflegt und
ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie in der Landwirtschaft arbeitete, was übrigens auch auf ihren Mann zutraf. Er besaß eine Art Federwagen, eine Mischung zwischen Ackerwagen und Kutsche, ein
verkürz- ter Wagenmit Ladefläche. Häufig fuhr er damit in aller Ruhe vorbei an unserem Haus, um auf den Feldern nach dem Rechten zu sehen. Schon der Weg dorthin dauerte min- destens eine halbe
Stunde.Wenn hingegen sein Knecht – er hieß Recker – vorbei kam, dann ging es flotter und der Wagen war mit Werkzeug, Geräten usw. beladen. Als Brenner war Vissing ein wahrer Feinschmecker, was die
Wasserqualität anging.Wir fühlten uns sehr geschmeichelt, als er einmal Wasser von der Pumpe unserer Wiese ent- nahm und meinte, es sei einzigartig und viel besser als jedes andere, was er sonst
kenne. Das tat unsgut, dassVissing unser Pumpenwasser mochte und wir haben das dann auch weiter erzählt! Vissing trank unser Wasser! Vissings besaßen vor der Stadt in derNähe unseres Hauses eine
Scheune, in derStroh und größere Maschinenuntergebracht waren. Das Gebäude standganz alleine auf wei- ter Flur, und zwar dort, wo jetzt die Maschinenfabrik Peters ist. Ob und wie- viel Vieh man an
der Oststraße hinter der Brennerei und Gastwirt-schaft hielt, vermag ich nicht zu sagen. Ich erinnere mich nur, dass man immer wieder sah, dass Schlempe aus den Brennereien über die Gosse in den
Gulli lief, woraus man schließen kann, dass der Verbrauch an bzw. die Nachfrage nach Schlempe geringer gewesen sein muss als die Produktion. Ganz ähnlich gekleidet wie Herr Lainck- Vissing war der
Brennereibesitzer Rötering auf der Weststraße, der neben einem Verwalter etliche weitere Angestellte unterhielt. Ich erinnere mich, dass der Verwalter mit Namen Brand hieß, von einem ostpreus-
sischen Gut kam und stets mit blank gewichsten Lederstiefeln umherschritt.
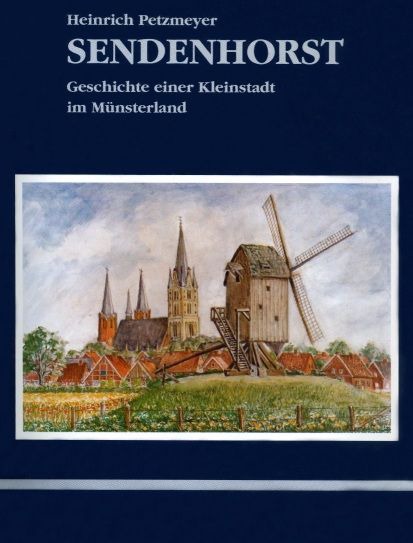 Abb.149: Brennerei Rötering an der Weststraße
Abb.149: Brennerei Rötering an der Weststraße
Röterings besaßen einen großen Acker gegenüber meinem Elternhaus, dort, wo sich heute der Mar- tiniring
befindet. Wir nannten ihn Röterings Brink. Wenn auf die- sem Feld gearbeitet wurde, erschien Herr Brand mit seinen blanken Stiefeln auf dem Fahrrad und wies die Knechte an, was sie tun sollten.
Abb.150: Anita und Heinrich Rötering
Bei Röterings arbeitete auch der Melker Meier, der als Flüchtling mit seiner Familie aus Westpreussen gekommen war. Er war Bauer gewesen, bescheiden und fleißig und schaffte es, in kurzer Zeit drei
Häuser zu bauen.
Abb.151: Haus Jönsthövel um 1950
An der Ecke Schulstra- ße/Nordstraße stand das wunderschöne Fach- werkhaus des Gast- wirts und Brennereibe- sitzers Jönsthövel. Er war ein massiger Mann, der sich meist im Obergeschoss des Hau- ses
aufhielt, während „Tante Trudis“ – sie war groß und schlank, unverheiratet und die Gute Seele des Hauses - im Gastraum die Stel- lung hielt.
Abb.152: Theodor und Antonie Jönsthövel
Nach dem Krieg hatte er sich noch eine Kutsche und eine Wagenremise bauen lassen, die in einem großen Garten neben dem bis heute vorhandenen Schlachthaus von Laurenz Koch stand. Nach dem Tod von Theo
Jönsthövel hatte ich die Möglichkeit, von den Erben diese Kutsche zu erstehen.
Abb.153: Jönsthövelsche Kutsche mit Pferd
Das Haus wurde im Rahmen der Stadtsanierung abgebrochen – schade… Es war ein schönes Haus. Man ging durch eine Schwenktür in einem Vorraum über ein paar Stufen in die Gaststätte. Auf der linken Seite
befand sich die Theke und „Tante Trudis“, die den Gast leichtaufgestützt auf den Tresen nach seinen Wünschen fragte. Da ich bei meinem Onkel in der Neustraße den Beruf des Frisörs erlernte, hatte ich
immer wieder die Gelegenheit, das betriebli- che Geschehen der Brennerei Everke, Ecke Kirchplatz/Neustraße/ Placken, mit zu ver- folgen. Morgens warf der Sohn und Erbe, Eckart Everke, als erstes mit
der Hand den Lanz- Bulldog an – ein kleines Ungetüm, das fürchterlichen Lärm machte und die Straße und Häuser in Vibrationen versetzte.
Abb. 154: Remise Jönsthövel
Abb.155: Porträt Eckart Everke
Everkes hatten aber auch am Placken eine Remise, in der eine Kutsche – eine Art Jagdwagen – stand. Bis in die 50er Jahre hinein besaß man ein Reitpferd, ein wirklicher Luxus in dieser Zeit. Man hatte
Pferde für die Feldarbeit und auch leichtere Pferde, um am Sonntag zur Kirche zu fahren; ein ausgesprochenes Reitpferd war jedoch in Sendenhorst eine Seltenheit.
Das öffentliche Engagement der Sendenhorster Kornbrenner
Die Sendenhorster Kornbrenner und ihre Angehörigen brachten sich noch in vielen anderen Bereichen des städtischen Lebens ein. Leider konnten im Rahmen der Ausstellung und dieses begleitenden
Ausstellungsbandes aufgrund der Fülle des Materials nur bestimmte, für die Entwicklung des kommunalen Lebens besonders wichtige Aktivitäten und Leistungen angesprochen werden.
Abb.156: Zeitungsbericht: Josef Horstmann zum 80. Geburtstag
So haben etliche Brennereibesitzer sich in der Kreis- und Kommunal- politik oder anderen öffentlichen Ämtern bewährt - als Abgeordneter im Kreistag (u.a. Josef Horstmann), als stellvertretender oder
erster Bürgermeister (Edmund Panning, Rudolf Bonse), als Gemeindevor- steher im Kirchspiel (Gerhard Zurmühlen), als Stadtrat und/oder sachkundiger Bürger in Ausschüssen (Josef Arens-Sommersell,
Rudolf Bonse, Carl Werring, Karl Werring jun.), als Schiedsmann,Verwalter der Armenkasse und als Vormund.
Abb.157: Stadt- und Amtsvertretung Sendenhorst, darunter mehrere Brenner Dass man als Stadtrat manchmal auch ungewöhnliche Aufgaben wahrnehmen musste, zeigt das folgende Bild. Hier wird das neue
Hallenbad durch das Mitglied des Sportausschusses und den Vorsitzender des Fördervereins zum Bau des Hallenbads, den Brennereibesitzer Josef Horstmann, durch einen Sprung ins Wasser eingeweiht.
Abb.158: Josef Horstmann beim Sprung ins Wasser des neuen Hallenbades Aber auch andere wichtige öffentliche Einrichtungen sind mit den Namen bekannter Kornbrenner verbunden. So stellten z.B. in der
Zeit 1893-1967 die Familien Bonse und Everke die Wehrführer in der Freiwilligen Feuerwehr (Theodor Bonse 1893- 1906;Wilhelm Everke 1907-1928; Heinz Everke 1929-1967),
Abb.159: Auszug aus dem Rahmen „Kornbrenner und Feuerwehr“ und die Familie Bonse war für „Sieben Menschenalter“ für die Poststation zuständig.
Abb.160: Heinz Everke als Wehrführer
Viele Brennerfamilien haben sich durch ihre langjährige Mitgliedschaft und aktive Teil- nahme in den verschiedensten Vereinen, Jagdverbänden und - genossenschaften, kulturellen und karitativen
Einrichtungen, um das städtische Gemeinwesen verdient gemacht. So ist zum Beispiel die Entwicklung des Allgemeinen Schützenvereins ohne die Familie Werring und die durch Verwandtschaft verbundene
Familie Jönsthövel kaum denk- bar. Lange Jahre zeichnete Carl Werring für die Vereinsleitung verantwortlich, zwei Mal stellte man den Schützenkönig (1937: Karl Zurmühlen, gnt. Werring; 1984 Carl
Werring), einmal die Schützenkönigin (1933: Änne Zurmühlen, gnt.Werring).
Abb.161: Auszug aus dem Rahmen der Familie Bonse betr. die Posthalterei
Abb.162: Schützenverein -Thron 1937
Abb.163: Carl Werring als Schützenkönig 1984
Erwähnt werden sollen auch die Ehefrauen zweier Kornbrenner, die sich in ganz besonderer Art und Weise um die Allgemeinheit gekümmert haben: Magdalene Arens- Sommersell und Anita Rötering. Über
Jahrzehnte war Magdalene Arens-Sommersell im WLLV (Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband) tätig. Während dieser Zeit war es ihr als Vorsitzende des Sendenhorster Landfrauenverbandes, aber auch im
Rahmen ihrer Arbeit auf Kreis- und
Abb.164: Magdalene Arens-Sommersell bei einer Ausstellung der Landfrauen in der Volksbank Landesebene, ein besonderes Anliegen, die Weiterbildung der Mitglieder im berufli- chen, sozialen,
politischen und kulturellen Bereich voranzutreiben, Tradition und Brauchtum zu pflegen und das Leben auf dem Lande attraktiv zu gestalten.
 Abb.165: Porträt Anita Rötering
Abb.165: Porträt Anita Rötering
Anita Rötering kam durch ihre Heirat mit dem Brennereibesitzer Heinrich Rötering 1924 nach Sendenhorst. Wie ihre Schwiegermutter, Maria Rötering, geb. Brüning, unterstützte sie als Mitarbeiterin und
Vorsitzende auf Orts- und Kreisebene über Jahrzehnte die Arbeit des Vaterländischer Frauen-Zweigvereins des DRK und die spätere „Frauenarbeit des Deutschen Roten Kreuzes“. Für diese Leistung, aber
auch die Tatsache, dass sie 25 Jahre lang dem DRK-Ortsverein ihr Haus Weststraße 15 unentgeltlich zurVerfügung stellte, erhielt sie 1969 das Bundesverdienst- kreuz am Bande. Eine ganz besondere
Aktion der Sendenhorster Kornbrenner war ein Benefiz-Fußballspiel im Jahre 1950, bei dem die „Brenner“ gegen die „Verbraucher“ antraten, um Gelder für die Errichtung einer neuen Sporthalle am Westtor
aufzubringen. Fast alle damals aktiven Brennereibesitzer waren dabei vertreten. Die beiden Mannschaften marschierten mit Blasmusik durch die Stadt zum Fußballplatz.
Abb.166: Aufmarsch der Fußball-Mannschaften mit Kapelle 1950 Die folgenden beiden Bilder zeigen die Mannschaften. Abb.167: Die Fußballmannschaft der „Brenner“
von links nach rechts: Josef Arens-Sommersell, Rudolf Bonse, Carl Zurmühlen (dama- liger Pächter der Brennerei Hallermann/ehemals Panning), Reinhold Zurmühlen (Jönsthövel), Josef Silling
(„Osten-Silling“), Heinz Everke, Willi Hankmann (Lainck- Vissing), Carl Werring, Carl-August Graute, Heinz Zurmühlen, J.Silling (Westen- Silling).
Abb.168: Die Fußballmannschaft der „Verbraucher“
Von links nach rechts:Wegmann, ?, Clemens Daldrup,Theo Bücker,Willi Brinkmann (Lehrer), ?, Overhage, Männe Geiping, Bernhard Brummel, Josef Kleinhans, Adolf Heiringhoff.
Interessant ist, dass die Sendenhorster Kornbrenner hier öffentlichkeitswirksam als Gruppe auftraten, die sich gemeinschaftlich für ein allgemeines kommunales Anliegen einsetzt.
V. Anhang Abbildungsverzeichnis
Abb.1: Hausfrau am Destillierofen (aus Schrick, Michael, Doctor der Ertzney:Von allen geprennten Wassern. Augsburg 1480)
Abb.2: Hausfrau in der Brennstube (aus Florinus, Haus Vatter 1702)
Abb.3: Plan der Brennereianlage des Theodor Wieler mit Unterfeuerungskessel (1854)
Abb.4: Sicherheitsventil der Kesselanlage des Heinrich Beumer (1856)
Abb.5: Anlage der Brennerei des Hermann Böcker/Oststraße (1854)
Abb.6: Brennapparat mit Kühler des Christian Silling/Oststraße (1859)
Abb.7: Neubau der Brennerei Bonse/Südstraße (1876)
Abb.8: Circulations-Wasserrohrkessel Brennerei Bernhard Rötering (1889)
Abb.9: Brennerei Edmund Panning mit stehendem Dampfkessel (1909)
Abb.10: Sendenhorst um 1950 aus südwestlicher Richtung. Zu sehen sind die Schornsteine der Brennereien Rötering, Graute, Jönsthövel, Everke (hinter Kirchturm), Panning, Lainck-Vissing/Oststraße und
Silling/Oststraße
Abb.11: Lageplan/Grundriss des Grundstücks Lainck-Vissing (1910)
Abb.12: Brennereianlage Josef Horstmann (1975)
Abb.13: Brennereianlage-Schema Josef Arens-Sommersell (1951)
Abb.14: Maische-Destilliergerät/Rohbrandkolonne Arens-Sommersell (1951)
Abb.15: Rektifiziergerät/Feinbrandkolonne Horstmann (1963)
Abb.16: Henzedämpfer Brennerei Werring (1918)
Abb.17: Neues Brennereigebäude Rötering (1934/35)
Abb.18: Schreiben an H. Brüning betr. „Abverfügung“ von Brenngetreide und Malz an J.H. Everke (29.12.1945)
Abb.19: Schreiben an verschiedene Brennereien betr. „Transfer of Stocks“ an Everke (12.1.1946)
Abb.20: Schmiede Münstermann (heute Buschkötter)
Abb.21: Reklame Schmiede Münstermann
Abb.22: Innenraum Brennerei Rötering
Abb.23: Haus Münstermann an der Weststraße; im Hintergrund die Einfahrt von Graute
Abb.24: Luftbild des Hofes und der Brennerei Graute (heute Kleinhans)
Abb.25: Situationsplan Graute (1923)
Abb.26: Weststraße mit altem Sommersellschen Haus links, Haus Rötering rechts
Abb.27: Kastenwagen vor der Gaststätte und Brennerei Jönsthövel
Abb.28: Ehemaliges Haus Silling an der Weststraße (Westen-Silling)
Abb.29: Grabstein des Brennereibesitzers Silling
Abb.30: Fragebogen für die Erstattung von Mietausfällen für durch die Militärregierung besetzten Wohnraum im Haus Roetering in der Weststraße
Abb.31: Werbung für den deutschen Korn in den 50er Jahren
Abb.32: Etikett Everke für den Export in die USA
Abb.33: Wohnhaus Arens-Sommersell bis 1970
Abb.34: Grundstück Arens-Sommersell/Schlecker heute
Abb.35: Luftbild Grundstück Graute vor 1970
Abb.36: Haus Graute/Kleinhans heute
Abb.37: Luftbild Grundstück Everke vor 1970
Abb.38: Luftbild Grundstück Everke heute
Abb.39: Wohnhaus Hallermann/Panning vor 1970
Abb.40: Grundstück Panning/Wiedehage heute
Abb.41: Gaststätte/Brennerei Jönsthövel um 1950
Abb.42: Grundstück Jönsthövel/Metzgerei Koch heute
Abb.43: Gaststätte/Brennerei Lainck-Vissing/Hankmann 1910
Abb.44: Haus Hankmann/Börse heute
Abb.45: Luftbild von Südwesten um 1970; Grundstück Rötering mit Villa und Brennerei
Abb.46: Villa Rötering heute
Abb.47: Gaststätte/Brennerei Silling, Oststraße vor 1970
Abb.48: Haus Silling/Westhagemann heute
Abb.49: Grundstück/Brennerei Bonse, Südstraße vor Sanierung
Abb.50: Grundstück Bonse heute
Abb.51: Haus Silling,Weststraße heute
Abb.52: Hotel/Ridder/Herweg (früher Brennerei Topp) vor Abriß
Abb.53: Grundstück Herweg/Volksbank heute
Abb.54: Gaststätte/Brennerei Neuhaus/Suermann am Kirchplatz vor Sanierung
Abb.55: Grundstück Suermann/Ärztehaus heute
Abb.56: Hof Horstmann (Gemälde)
Abb.57: Luftbild Hof Horstmann mit Brennerei heute
Abb.58: Wohnhaus Hof Telges-Homann mit Brennereigebäude links (um 1946)
Abb.59: Ehemalige Brennerei Telges-Homann heute
Abb.60: Hof Schulze Tergeist heute
Abb.61: Ehemaliges Brennereigebäude Hof Vrede/Bauerschaft Rinkhöven heute
Abb.62: Hof Werring mit altem Wohnhaus und Brennerei (vor 1920); Hof mit neuem Wohnhaus (nach 1923)
Abb.63: Brennerei Werring heute
Abb.64: Wohnhaus Telges-Homann (um 1946)
Abb.65: Im Namen des Volkes! Urteil zugunsten Telges-Homann i.S. Kleinhandel (1934)
Abb.66: Plan zum Concessionsbescheid 1931 für Kleinhandel in der Diele des Hauses Rötering an der Weststraße
Abb.67: Legitimationskarte für inländische Kaufleute, Handlungsreisende und Handlungsagenten für Josef Arens (1931)
Abb.68: Josef Arens auf Kutschwagen mit Fass Münsterländer Korn
Abb.69: LKW zum Vertrieb der Produkte der Brennerei Werring
Abb.70: Luftbild Gesamtkomplex Jönsthövel (um 1970)
Abb.70a: Gaststätte Jönsthövel mit Haus Pöttken um 1950
Abb.71: Petroleumkanne aus der GaststätteJönsthövel
Abb.72: Grundriss der Gaststätte und des Wohnhauses Lainck-Vissing/Hankmann
Abb.73: Diele/Gastraum der Gaststätte Lainck-Vissing
Abb.74: Standuhr aus der Gaststätte Jönsthövel (heute Haus Schulte/Ahlen)
Abb.75: Schulstraße mit Kutschen vor dem Ausspannhof Jönsthövel
Abb.76: Befüllung einer Korbflasche mit Trichter (Hermine Schulte)
Abb.77: Hermine Schulte mit diversen Geräten aus Brennerei und Gaststätte Jönsthövel
Abb.78: Alte Schnapsgläser aus der Gaststätte Jönsthövel
Abb.79: Luftbild Brennerei Jönsthövel
Abb.80: Kutschwagen vor Jönsthövel
Abb.81: Theodor Jönsthövel
Abb.82: Theodor Jönsthövel mit Jagdgenossen, darunter die Kornbrenner Willi Hankmann, Heinz Everke, und Reinhold Zurmühlen.
Abb.83: Mercedes der Familie Jönsthövel, mit dem u.a. auch der Korn zu den Kunden gebracht wurde.
Abb.84: Belgier mit Hermine im Garten Jönsthövel
Abb.85: Erfassungsbescheid an Heinrich Roetering wegen Anforderung von Teppichen für Militärregierung
Abb.86: Zeitungsausschnitt zum Abriss des Hauses Jönsthövel
Abb.87: Vor der Gaststätte Jönsthövel
Abb.88: Großvater Höne mit Familie (links Bernd Höne)
Abb.89: Blick von St. Martin auf die Oststraße bzw. die Häuser Silling und Drees auf der linken Seite
Abb.90: Kundenschreiben an die Brennerei Rötering (1941)
Abb.91: Messestand der Brennerei Everke in Dortmund (um 1950)
Abb.92: Ausstellung – Platte mit Etiketten Sendenhorster Brennereien
Abb.93: Ettikett der Brennerei Vissing mit Falstaff-Figur
Abb.94: Etikett der Brennerei Werring mit Sämann
Abb.95: Bestellung von Plakaten durch die Brennerei H.Brüning/Rötering – Auftragsbestätigung (1901)
Abb.96: Zeitungsbericht über die Aufstellung der ersten Litfasssäule in Sendenhorst (um 1900)
Abb.97-101:Werbetexte diverser Sendenhorster Kornbrennereien
Abb.102: Familie Arens-Sommersell zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.103: Familie Bonse zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.104: Familie Jönsthövel zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.105: Familie Schulze Rötering/Gaßner zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.106: Familie Werring zum Thema “Öffentliches Engagement“
Abb.107: Rahmen zum Thema „Kornbrenner in der Freiwilligen Feuerwehr“
Abb.108: Sparkasse heute
Abb.109: Haus Rötering,Weststraße 13 – „Wiege der Sparkasse“
Abb.110: Kontor des ersten Rendanten der Sparkasse, Heinrich Brüning
Abb.111: Volksbank heute
Abb.112: Hotel Herweg vor dem Abriss im Zuge der Stadtsanierung
Abb.113: Luftbild Neubau Volksbank
Abb.114: Porträt Heinrich Brüning
Abb.115: Porträt Bernhard Rötering
Abb.116: Luftbild Rathaus mit Neubau Sparkasse
Abb.117: Porträt Brennereibesitzer Vrede – Mitglied im Curatorium der Sparkasse
Abb.118: Nachruf Gerhard Werring – Mitglied im Curatorium der Sparkasse
Abb.119: Sparkassenvorstand und –rat 1967 mit dem Brenner Carl Werring
Abb.120: Volksbankmotto „Bring us dien Geld, legg’t nich in Pott…“
Abb.121: Haus Düning (früher Mettler/heute Schwermann) – erste Geschäftsstelle der Spar- und Darlehenskasse
Abb. 122: Einladung zur ersten Generalversammlung im Hause des Brennereibesitzers Theodor Wieler (heute Haus Plüschke)
Abb.123: Josef Arens, gen. Sommersell – von 1897-1901 Mitglied des Vorstandes der Volksbank
Abb. 124: Theodor Telges-Homann – von 1905-1909 Mitglied des Aufsichtsrates der Volksbank
Abb.125: Karl Zurmühlen/Werring – von 1928-1942 im Aufsichtsrat, von 1942-1945 Vorstandsvorsitzender der Volksbank
Abb.126: Beirat der Spar- und Darlehenskasse (Datum? Namen?)
Abb.127: Haus Everke heute
Abb.128: Senta Fronholt mit ihrem Mann Josef Fronholt
Abb.129: Senta Fronholt mit Kindern im Garten
Abb.130: Die Ausspannstätte Gaststätte Peiler (Bild Bernd Höne)
Abb.131: Gasthof Suermann am Kirchplatz (heute Ärztehaus neben Apotheke)
Abb.132: Werbung Suermann
Abb.133: Hochzeitszug vor der Gaststätte Suermann
Abb.134: Grundriss des gesamten Anwesens Suermann
Abb.135: Totenzettel von Gertrud Suermann (1888-1959)
Abb.136: Hotel Klümper/später Hotel und Gaststätte Kaupmann
Abb.137: Gaststätte Kaupmann kurz vor dem Abriss
Abb.138: Sitzecke bei Kaupmann
Abb.139: Theke mit dem Wirtsehepaar Kaupmann
Abb.140: „Stammtisch“ bei Kaupmann
Abb.141: Werbung der Gaststätte Kaupmann
Abb.142: Wohnhaus und Brennerei Lainck-Vissing vor der Sanierung
Abb.143: Brennerei Vissing während des Abbruchs des Hauses Northoff (um 1958), an dessen Stelle die Sparkasse gebaut wurde
Abb.144: Porträt Heinrich Lainck-Vissing in Jagdkleidung
Abb.145: Diele und Gastraum im Haus Lainck-Vissing
Abb.146: Alter Hof Horstmann mit kleinem Fachwerk-Brennereigebäude
Abb.147: Porträt Heinrich Lainck-Vissing
Abb.148: Ehepaar Lainck-Vissing im Hof des Grundstücks. Auf der Wand über der Sitzecke ist zu lesen: “Was Du ererbt von den Vätern, erarbeite es, um es zu besitzen.“
Abb.149: Brennerei Rötering an der Weststraße
Abb.150: Anita und Heinrich Rötering
Abb.151: Haus Jönsthövel um 1950
Abb.152: Theodor und Antonie Jönsthövel
Abb.153: Jönsthövelsche Kutsche mit Pferd
Abb.154: Remise der Familie Jönsthövel
Abb.155: Porträt Eckart Everke
Abb.156: Zeitungsbericht: Josef Horstmann zum 80. Geburtstag
Abb.157: Stadt- und Amtsvertretung Sendenhorst, darunter mehrere Brenner
Abb.158: Josef Horstmann beim Sprung ins Wasser des neuen Hallenbades
Abb.159: Auszug aus dem Rahmen „Kornbrenner und Feuerwehr“
Abb.160: Heinz Everke als Wehrführer
Abb.161: Auszug aus dem Rahmen der Familie Bonse betr. die Posthalterei
Abb.162: Schützenverein -Thron 1937
Abb.163: Carl Werring als Schützenkönig 1984
Abb.164: Magdalene Arens-Sommersell bei einer Ausstellung der Landfrauen in der Volksbank
Abb.165: Porträt Anita Rötering
Abb.166: Aufmarsch der Fußball-Mannschaften mit Kapelle 1950
Abb.167: Die Fußballmannschaft der „Brenner“
Abb.168: Die Fußballmannschaft der „Verbraucher“
Grafik 1: Lieferorte Brennerei Theodor Schwarte (1822-1856) Grafik 2: Branntwein-Vertrieb Brennerei Werring (1848-1867)
Grafik 3: Branntwein-Vertrieb Brennerei Werring (1900-1918)
Grafik 4: Branntwein-Vertrieb Brennerei Horstmann (1930-1940)
Autoren der Erinnerungen „Rund um den Sendenhorster Korn“
Magdalene und Josef Arens-Sommersell sind bis heute Besitzer einer Brennerei, die 1970 von der Weststraße 234 auf den Hof Geilern in der Bauerschaft Hardt ausge- lagert wurde. Wohnhaus,
Wirtschaftsgebäude und Brennerei wurden im Zuge der Stadtsanierung abgerissen. Das Grundstück wurde mit einem modernen Wohn- Geschäftshaus bebaut (heute Schlecker).
Senta Fronholt wurde 1929 in Fellhammer im Kreis Waldenburg in Niederschlesien geboren. 1946 kam sie im Zuge der Zwangsumsiedlung in den Westen nach Sendenhorst. In den Jahren vor ihrer Heirat mit
dem Schreiner Josef Fronholt im Jahre 1953, war sie in mehreren Sendenhorster Haushalten beschäftigt, darunter auch als Köchin und Haushilfe bei der Brennereifamilie Everke am Kirchplatz.
Bernd Höne wurde 1940 als Sohn des Maurerpoliers Theodor Höne in seinem Elternhaus am Osttor Nr. 88 geboren. Nach einer Ausbildung als Frisör absolvierte er ein Studium an der pädagogischen
Hochschule in Münster und arbeitete dann 20 Jahre als Lehrer anSchulen in Ahlen. Schon als Kind faszinierten ihn die Pferdegespanne und Kutschen, die im damaligen Sendenhorst noch allgegenwärtig
waren. Der frühe Wunsch, selbst eine Kutsche zu besitzen, führte zu einer umfassenden Kutschensammlung und der Eröffnung des weit über Sendenhorst bekannten Kutschenmuseums im Garten seines Hauses am
Teigelkamp. Seine beiden Beiträge
„Opas Flachmann und die Brennerei und Gaststätte Silling“ und „Sendenhorster Brenner aus dem Blickwinkel eines Kindes“ beziehen sich auf den Zeitrahmen 1946 bis 1953.
Bernhard Münstermann wurde am 22.10.1931 in Sendenhorst als Sohn des Schmiedemeisters Münstermann geboren. Er wuchs an der Weststraße auf, wo sein Vater gegenüber der Brennerei Graute eine Schmiede
besaß (heute Buschkötter), die später unter dem Sohn in das Industriegebiet ausgelagert und als landwirtschaftlicher Reparaturbetrieb weitergeführt wurde. Die hier aufgezeichneten Erinnerungen, die
sich weitgehend auf den Zeitraum 1940 bis 1970 beziehen, stammen aus einem Gespräch mit BernhardMünstermann, das im November 2006 im Beisein der Familie Arens-Sommersell geführt wurde.
Dieter Obermeyer, 1923 in Münster geboren, wuchs in Sendenhorst als Sohn des Lehrers Paul Obermeyer auf. 1942 wurde der damals 19jährige zur Wehrmacht einbe- rufen. Erst im Jahre 1948 kehrte er aus
französischer Gefangenschaft zurück. Seine Beiträgebeziehen sich mehrheitlich auf die Zeit 1930 bis 1942, teilweise aber auch auf die Jahre 1948/1949.
Hermine Schulte wurde 1936 als Tochter des Alois Zurmühlen und seiner Ehefrau Johanna, geb. Löbke geboren. Der Vater stammte vom Hof Werring und heiratete nach Hembergen bei Emsdetten. Als Nichte des
Ehepaars Theodor Jönsthövel und Antonia, geb.Zurmühlen, kam sie 1942 das erste Mal zu Besuch nach Sendenhorst. Nach meh- reren Ferienaufenthalten wurde beschlossen, dass sie die gesamte Schulzeit im
Hause Jönsthövel bei Onkel und Tante verbringen sollte. Ihre Erinnerungen beziehen sich auf ihre Jugendzeit 1942 bis ca.1962.
Marianne Werring wurde 1932 als Tochter des Caspar Roeren-Schotte und seiner Frau Maria, geb. Kleine-Westhoff, auf dem Hof Roeren-Schotte geboren. 1957 heira- tete sie Carl Werring, der 1965 den Hof
und die Brennerei Werring übernahm. Ihre Erinnerungen zum „Ausspannhof“ Gaststätte Suermann beziehen sich auf die Jahre 1938 bis ca.1962. Woher hat der Arbeitskreis Stadtgeschichte seine
Informationen? In dem vorliegenden Begleitband zur Ausstellung wurde bewusst auf Fußnoten mit Quellen- und Literaturangaben verzichtet. Im Folgenden sollen aber wenigstens die besuchten Archive und
die wichtigste verwendete Literatur aufgelistet werden.
Das Informations- und Quellenmaterial stammt aus:
° Interviews mit Josef und Magdalene Arens-Sommersell, Hildegund Bonse, Erika und Eckart Everke, Josef und Jochen Horstmann, Wolfdieter Gaßner/
Schulze Rötering, Hermine Schulte, Carl und Marianne Werring, Bernhard Schmies, Max-Fritz Schunk und Dieter Obermeyer;
° den Familienarchiven Arens-Sommersell, Bonse, Everke, Hankmann/Lainck- Vissing, Horstmann, Schulze Rötering und Werring;
° dem Stadtarchiv Sendenhorst (u.a. den sog. Spezialakten zum Betrieb von Dampfkesselanlagen für die innerstädtischen Brennereibetriebe, Steuerlisten, Fotoarchiv);
° dem Kreisarchiv Warendorf (u.a. den sog. Spezialakten für Brennereibetriebe im Kirchspiel, den sog. Amtsblättern mit den Öffentlichen Bekanntmachun- gen, Pressemitteilungen);
° dem Staatsarchiv (u.a. den Steuerakten, amtlichen Schriftverkehr zur Entwicklung des Gewerbes).
Verwendete Literatur:
Festschriften
° 1884-1994. 110 Jahre Deutscher Kornbrennerverband. Eine Bestandsaufnah- me zum 110jährigen Bestehen der Verbandsorganisation deutscher Kornbren- ner. Dortmund 1994.
° Festschrift zum 75jährigen Bestehen der Volksbank.
° Freiwillige Feuerwehr Sendenhorst. Festschrift zum 65jährigen Jubelfest am
13. und 14. August 1950. Sendenhorst 1950.
° Werden und Wachsen. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Sparkasse der Ämter Sendenhorst und Vorhelm. Sendenhorst 1967.
° Werland, Peter: Sendenhorst. Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestehens der freiwilligen Feuerwehr zu Sendenhorst am 7. und 8. August 1910. Münster
1910.
Abresch, Werner/Kaiser, Friedhelm: Zukunft gewinnen. F.W. Raiffeisen. Ein großes Leben in Bildern und Dokumenten. Hannover 1968.
Delbrück, Max: Illustriertes Brennerei-Lexikon. Berlin 1915.
Horn, Erna: Branntewein aus Frauenhand. Historie vom Branntewein. München 1977.
Macher, Lorand: Leitfaden in der Kornbrennerei-Praxis. Strothmann. Technologie des Gärungsgewerbes. Bd. I. Minden 1950.
Peters, Franz-Joseph: Entwicklung und Bedeutung des Brennereigewerbes in Westfalen. Emsdetten 1930.
Petzmeyer, Heinrich: Sendenhorst. Geschichte einer Kleinstadt im Münsterland. Sendenhorst 1993.










































































































































































































































































































































































 Polizeibericht
Polizeibericht


















