Sagen & Erzählungen aus Sendenhorst 01.06.2015 | A. Stafflage 1952
Sagen, Spukgeschichten und Erzählungen gibt es auch hier in Sendenhorst; Im Stadtarchiv lässt sich folgender Text vom Lehrer Stafflage finden, der hier originalgetreu wiedergegeben wird:
Vor 20 Jahren (1932, also mittlerweile 83 Jahren) stießen Arbeiter auf dem Steinkühlerfeld (Ahlener Damm in Richtung Ahlen) auf zwei Urnen, die 42 Gold- und 3.000 Silbermünzen enthielten. Sie müssen
um 1425 n. Chr. der Erde anvertraut sein. Eigenartig ist, daß die Aufdeckung des Schatzes fast völlig übereinstimmt mit dem Inhalt einer Sage
DER VOLKSMUND BERICHTET:
Einst ritt ein Kaufmann bei Sendenhorst über die alte Handelsstraße. Hin und wieder griff er nach seinem reich mit Geldstücken gefüllten Felleisen, das er am Sattelzeuge befestigt hatte. Freundlich
grüßte er einen Landmann, der neben der einsamen Straße mit seinen Gäulen braune Furchen in den holprigen Acker zog. Als dieser dem Reiter nachblickte, sah er, wie sich ein Gegenstand vom Pferde
löste und auf die Erde fiel.

Bild:
Der große Hardtteich: Hier soll er umgehen, der große schwarze Hund - Hier möchte man ihm lieber nicht begegnen... Foto: Jürgen Peuker 2014
Er lief nach der Stelle und war außer sich vor Freude, als ihm aus einem Ledersack viele Geldstücke entgegenblinkten. Der Bauer versteckte das Geld und pflügte ruhig
weiter. Inzwischen hatte der Kaufmann den Verlust seines Vermögens bemerkt. Wiederholt ritt dieser die letzte Wegstrecke auf und ab. Vergebens untersuchte er jedes Schlagloch und jede Wagenspur. In
der festen Überzeugung, daß nur der Bauer das Geld haben könne, ritt er auf den Acker und fragte den Landmann nach dem Schatz. Doch dieser schaute kaum auf. Ihn störte weder das Flehen des Kaufmanns
noch eine versprochene hohe Belohnung. Zuletzt rief der verzweifelte Reiter dem Finder die Worte zu: »Nur du kannst mein Geld haben. Der Fluch soll an dem Schatz kleben. Keinem soll er Glück bringen.
Niemals soll auf deinem Hofe ein männlicher Erbe geboren werden!« Dann sprengte er davon. Ein unheimliches Grauen erfasste den Bauern. Krumm und schief lief der Pflug durch das Land. »Lieber will ich
einen Erben haben als das viele Geld«, murmelte er grübelnd vor sich hin. In der Abenddämmerung ging er hin und vergrub den Schatz. Das streng gehütete Geheimnis nahm er mit ins Grab. Es ist
Tatsache, dass der eingangs genannte Gold- und Silberschatz den Findern und den Aufkäufern kein Glück gebracht hat.
EINE ANDERE ERZÄHLUNG REICHT EBENFALLS INS MITTELALTER ZURÜCK.
Damals zählte der Sendenhorster Freistuhl, der sich an der Königsstraße unweit des Hofes Tergeist befand, zu den bedeutendsten in Westfalen. Zu den Unschuldigen, die der Feme zum Opfer fielen,
gehörte ein angesehener Bürger namens Hesso. Dieser, so erzählt man, war mit vielen Gästen zu einer Hochzeit auf dem Hofe Schulze Horstrup geladen. Die anwesenden Schöffen der Feme unterhielten sich
in einer geheimnisvollen, den anderen Gästen nicht verständlichen Sprache über Bürger, die als verfemt dem Freigericht verfallen waren. Trotz der frohen Stimmung schenkte man ihnen kaum Beachtung.
Nur Hesso, der genau zugehört hatte, bedeutete ihnen, daß er sie verstanden habe. In der Angst, daß Hesso sie verraten könne, schmiedeten die entsetzten Schöffen einen furchtbaren Plan. Sie brachen
auf, flochten einen Weidenstrick und lauerten ihm auf. Die Gäste rieten Hesso zu einem Umweg. Dieser lehnte ab. Als er jedoch auf dem Heimweg war, sprangen die Schöffen wie gemeine Mörder aus dem
Dickicht, warfen ihm die Weide um den Hals und hängten ihn an einem Baum auf. Diese Untat soll den Bischof als Landesherrn veranlaßt haben, die Feme in seinem Bezirk aufzuheben. Noch heute erinnert
ein am Weg stehendes Kreuz an jene Freveltat.
VON EINEM FAST UNDURCHDRINGLICHEN WALDSTÜCK IM KIRCHSPIEL GEHT FOLGENDE SAGE:
Auf einem naheliegenden Bauernhof verwalteten zwei Brüder gemeinsam das Erbe. Als sie später uneinig wurden, verdrängte man den rechtmäßigen Besitzer vom Hofe. Da dieser sich aber von seinem Gute
nicht trennen wollte, zog er in den nahen Wald. Von hohen Baumkronen aus hielt er täglich von früh bis spät Ausschau nach dem Leben und Treiben auf dem Hofe. Aber nur selten bekam man ihn zu Gesicht.
Die Sehnsucht und die Sorge um seinen Besitz ließen ihn auch nach dem Tode keine Ruhe finden. Weiterhin bewohnt sein Geist den Wald und die ringsum liegenden Wiesen, die er mitunter im Wirbelwind
umkreist. Jedes Jahr, berichtet der Volksmund, nähert sich der Geist um einen Hahnenschritt dem Hof. Noch vor einigen Jahren veranlasste ein unheimliches Geräusch, das sich entfernte, wenn man ihm
nachging, aber näher kam, wenn man zurückwich, zwei handfeste Bürger, die in dem Busch eine Weihnachtstanne holen wollten, zur Flucht.
NACH EINER WEITEREN ERZÄHLUNG SOLL SÜDLICH VON DER STADT DAS SPINNMÖDERKEN WOHNEN.
Vor ihm brauchte man keine Furcht zu haben, denn meist trat es als Freundin der Kirchspielbewohner auf. Doch zogen es die Kinder auf dem Schulweg vor, den Aufenthaltsort des Spinnmöderken zu
meiden.
VON EINEM GROSSEN KRIEG
Seit alters her hört man am Herdfeuer die folgende Erzählung: Einmal wird ein großer Krieg ausbrechen. Dann wird sich in der hiesigen Gegend eine blutige Schlacht abspielen. Wenn dann ein Hauptmann
durch das Südtor in die Stadt reitet, so ist das ein Zeichen, dass die Bevölkerung fliehen muß. Sie muss dann schnell das nötige Essen einpacken und sich drei Tage in »Fiehens Büschken« verborgen
halten. Während dieser Zeit wird der Feind im Osten und Süden der Stadt Kanonen auffahren und über Sendenhorst hinweg die Stadt Münster beschießen. Diese selbst wird dann in einen großen Steinhaufen
verwandelt werden.
WEITERE HERDFEUERGESCHICHTEN ERZÄHLEN VON EINEM SCHWARZEN HUND...
mit einem gewaltigen Kopf und zwei glühenden, zinntellergroßen Augen, der auf der Hardt sein Unwesen trieb, von einem Kaplan ohne Kopf, der sich im weiten Brökerfeld aufhielt, von dem Zauberer
Steltenkämper, der am »Witten Paohl« den Teufel traf, ihm seine Seele verschrieb und dafür einen Zauberstab bekam.
Vom Rathaus und von seinen Bürgermeistern Vor 1960 | Bernhard Fascies
Über das Rathaus in Sendenhorst & dessen Bürgermeistern gibt es viel zu berichten. SENDENHORST Um zwei Mittelpunkte spielt sich in unserem westfälischen Landstädtchen seit dem ausgehenden Mittelalter das öffentliche Leben ab, und zwar um Kirche und Rathaus. Stellt jene das Wahrzeichen des religiösen Gemeinschaftslebens dar, so dieses den Mittelpunkt des städtischen Gemeinwesens. Beide ragen, wo ein glückliches Geschick es gefügt hat, als die Jahrhunderte überdauernde Zeugen wechselvoller geschichtlicher Vergangenheit in unsere Tage hinein. Sendenhorst kann sich solchen Glückes nicht freuen, denn Kirche und Rathaus, wie sie heute das Stadtbild beherrschen, verdanken einer sehr jungen Zeit ihr Entstehen.
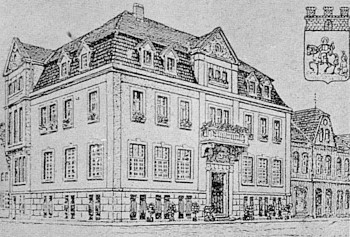 Bild:
Bild:
Das neue Rathaus mit dem Wappen
Von dem ältesten Rathaus der Stadt ist uns nichts mehr als die Nummer, die es im Häuserbuch der Stadt getragen hat, bekannt. Ein im Jahre 1750 von Pfarrer Dr. Kuipers angelegtes Verzeichnis führt es
als Nr. 234 auf. Die Mitteilung, so dürftig sie ist, besagt uns doch etwas sehr Wertvolles: Das älteste Rathaus hat nicht auf dem Platz des heutigen gestanden, es hat vielmehr im Nordviertel gelegen,
in der Nähe des Schöckingschen, jetzt Sickmannschen Hauses und der Schule. Hier mag es länger als seine kurzlebigen Nachfolger Bestand gehabt und als Wahrzeichen der Stadt Jahrhunderte überschaut
haben. Die unruhvollen Zeiten des ausgehenden Mittelalters, die religiösen Wirren der Reformation, die auch an die vom hl. Martinus beschützten Mauern Sendenhorsts ihre Wellen geschlagen hat, die
Zeiten, da vor gerade 400 Jahren die Wiedertäufer ihre Herrschaft in Münster gewannen und verspielten, die furchtbaren Jahrzehnte des 30jährigen Krieges, der Einfall der Spanier (1628) und Hessen
(1637), die harten Unglücksjahre des Siebenjährigen Krieges und der napoleonischen Fremdherrschaft waren Zeiten von Not und Tod, die das älteste Rathaus erlebt hat, da immer wieder die feindlichen
Mächte im Land standen und wie Wilde plündernd und mordend die Gegend unsicher machten. Sorgenvoll kamen dazumal die Ratsherren unter ihren beiden alljährlich aus der Bürgerschaft erwählten
Bürgermeistern in der Ratsstube zusammen, um zu beraten, wie sie die Lasten der Besatzung tragen, wie sie die Habe der Bürger schützen könnten. Aber es war nicht immer Krieg im Lande. Die glücklichen
Zeiten des Friedens mehrten Reichtum und Wohlstand der Stadt. Dann war es leichter, Bürgermeister und Ratsherr zu sein und manches Schützenfest der Johannisbrüder mag auf dem Saale des Rathauses
gefeiert worden sein, fröhliche Unterbrechung alltäglichen Dienstes. Ein altes Protokoll vom 11. 7. 1794 meldet der Nachwelt, daß das älteste Sendenhorster Rathaus auch für gesellige Zwecke
Verwendung fand. Jahrhunderte mag es so im Dienste der Bürgerschaft sein Leben gefristet haben, bis es im Jahre 1806 einem der furchtbarsten Brände, von dem Sendenhorst im Verlauf seiner Geschichte
heimgesucht wurde, zum Opfer gefallen ist. Dieser Rathausbrand ist ein eigenartiges Sinnbild des düsteren unheilvollen Zeitgeschehens zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Napoleons siegreiches Heer brach
in die deutsche Heimat ein, Jahre der Fremdherrschaft begannen, die vieles änderten. Der Bürgermeister leitete als „Maire“ die Geschicke der Stadt, die nach dem Friedensschlusse zwischen Napoleon und
dem König von Preußen im Jahre 1808 dem Großherzogtum von Berg einverleibt wurde. Dies war nach französischer Verwaltungseinteilung in Departements (etwa eine Provinz) gegliedert, die in
Arrondissements (Regierungsbezirke) zerfielen, die wiederum in Kantons (Kreise) eingeteilt waren. Maire Langen verwaltete also die Bürgermeisterei Sendenhorst im Kanton Ahlen, Arrondissement Hamm,
Departement der Ruhr.
Für viele Neuerungen französischen Stiles hatte das uns bekannte erste Rathaus seine Räume nicht mehr herzugeben brauchen. Doch hat es noch kurz vor seinem Untergange, als 1802 die Preußen Besitz
nahmen von dem alten Fürstbistum Münster, den Anbruch der neuen Zeit preußischer Herrschaft erlebt. Nach den Freiheitskriegen sollten diese endgültig die Geschicke der Stadt bestimmen. Es war der
neue Geist der Stein-Hardenbergschen Reform, der in die Verwaltung der Stadt Sendenhorst einzog. Am Marktplatz - erst der Brand von 1806 hatte diesen freien Platz im Herzen der Stadt geschaffen - war
inzwischen ein neues Rathaus erstanden; unter großen Opfern der bedrängten Bürgerschaft und nur auf das Notwendigste ausgerüstet. Es steht im Bilde, das uns glücklicherweise erhalten ist, vor uns. Es
hat die Freiheitsstürme von 1813 bis 1815 erlebt, aber auch die revolutionären vierziger Jahre sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Es sah 1864, 1866 und 1870/71 die Söhne der Stadt in den
Krieg ziehen, es war Zeuge wirtschaftlichen Niederganges und eines langsamen Wiederaufblühens der Bürgerschaft im Verlauf des 19. Jahrhunderts, über das es manche Alte und Urkunde aufbewahrt hat. Vor
allem aber ist es auf das stärkste von den innerpolitischen Veränderungen berührt worden, welche die preußische Zeit mit sich gebracht hat. Bei der Besitzergreifung Preußens 1802, als das alte und
umfangreiche Amt Wolbeck, zu dem Sendenhorst jahrelang gehört hatte, aufgelöst wurde, kam es zunächst zum Kreise Warendorf, nach den Freiheitskriegen zum Kreise Beckum, zu dem es heute noch gehört.
Damit wurden Bürgermeister und Ratsherren dem Regiment des Landrats unterstellt, das straffer war als das des Amtsdrosten von Wolbeck. Es mag wohl seine Zeit gedauert haben, bis sich der Maire Langen
und seine Nachfolger Rohr, Markus und Brüning und mit ihnen die Sendenhorster Ratsherren an die preußische Hoheit gewöhnt hatten. Das Jahr 1856 brachte mit der neuen Städte- und Landgemeindeordnung
eine weitere bedeutsame Veränderung in dem Verwaltungssystem des Rathauses. Bis dahin war Sendenhorst (Stadt und Land) zu einem politischen Gemeinwesen zusammengefaßt. Als Bürger sich nun für die
freie Städteordnung entschieden, wurde der ländliche Bezirk - die Kirchspielgemeinde - abgegliedert und dem Amte Vorhelm zugeteilt. Indes blieben in Zukunft Schule, Rathaus, Kirche und Friedhof
gemeinsames Eigentum. Im Jahre 1907 wurden jedoch die Rechte der Kirchspielgemeinde an das Rathaus abgetreten. Zwar hatten sich damals die Bürger an die eingewurzelte freiheitliche Selbstverwaltung
gewöhnt, und einen kollegialischen Gemeindevorstand (Magistrat) gewünscht, doch erhielten sie die Städteordnung mit einfacher Bürgermeistereiverfassung, die den kleinstädtischen Verhältnissen
dienlicher sei. Damit gingen alle Rechte und Pflichten des Magistrats auf den Bürgermeister über.
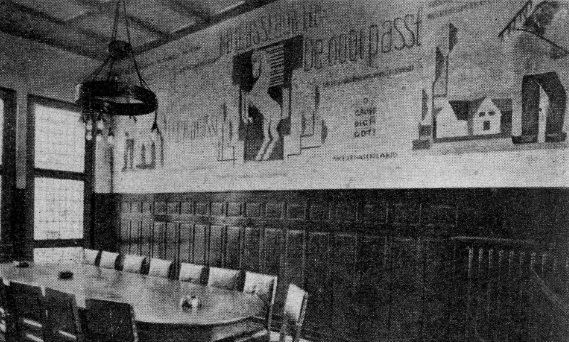 Wenige Jahre vor der
Durchführung der großen Verwaltungsreform waren umfangreiche Ausbesserungen im Rathaus notwendig geworden, die Bürgermeister Kreuzhage in den Jahren 1853/54 vornehmen ließ. Bis 1878 wurden 2-3 Räume
des Hauses für Schulzwecke verwendet. Noch mancher Sendenhorster wird das aus eigener Erfahrung bestätigen können.
Wenige Jahre vor der
Durchführung der großen Verwaltungsreform waren umfangreiche Ausbesserungen im Rathaus notwendig geworden, die Bürgermeister Kreuzhage in den Jahren 1853/54 vornehmen ließ. Bis 1878 wurden 2-3 Räume
des Hauses für Schulzwecke verwendet. Noch mancher Sendenhorster wird das aus eigener Erfahrung bestätigen können.
 Bild:
Bild:
Der Sitzungssaal des neuen Rathauses
Es ist gewiß als ein Zeichen des wirtschaftlichen Aufstieges der Stadt zu betrachten, wenn im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts Bürgermeister Hetkamp den Plan faßte, das alte Rathaus, das schon
recht baufällig geworden war, abzubrechen und ein stattlicheres an seine Stelle zu setzen. Wenn er auch anfänglich bei den Stadtverordneten auf Schwierigkeiten stieß, so verstand er es doch, sie von
der Notwendigkeit eines Neubaues zu überzeugen. Es wurden vorerst auch von der Aufsichtsbehörde Bedenken geltend gemacht, die sich vor allem auf die Platzfrage, den geplanten Abbruch des alten
Rathauses bezogen, denn das Rathaus besitze einen großen historischen Wert, und es läge im öffentlichen Interesse, daß dieses historische Denkmal im Schatten der prächtigen Plantanen der Nachwelt
erhalten bliebe. Bürgermeister Hetkamp wußte seinem Antrage in der Stadtverordnetensitzung vom 7. 6. 1910 „die Stadt ist gewillt, ein neues Rathaus zu bauen“ Annahme zu verschaffen. Die Anfertigung
der speziellen Pläne, Kostenanschläge sowie die Leitung wurden dem Architekten Diening in Münster übertragen, der sie im Einvernehmen mit dem Stadtverordnetenkollegium auszuarbeiten hatte. In 39
Sitzungen wurde darüber debattiert. Während des Winters 1910/11 wurde das vor 100 Jahren errichtete Rathaus abgebrochen. Am 28. 3. 1911 wurde die letzte Stadtverordnetensitzung im alten, dem Abbruch
verfallenen Rathause abgehalten, die späteren Sitzungen fanden in den provisorisch eingerichteten Räumen bei Düring statt. Das Material fand Verwendung bei dem Neubau eines Hauses, dem Krankenhause
gegenüber, das zunächst als Jugendheim mit Turnhalle, später ein Teil davon als Rektoratschule benutzt wurde und heute noch wird. Der Volksmund nennt es: das alte Rathaus. Am Marktplatz aber entstand
das neue Haus. Das Innere des Gebäudes erhielt eine würdige Ausstattung. Die bunten Fenster im Sitzungssaale und im Treppenhause wurden von der Firma Hange in Münster ausgeführt.
Im Herbst 1911 konnte das Rathaus seiner Bestimmung übergeben werden, wobei von einer öffentlichen Feier aus Sparsamkeitsrücksichten Abstand genommen wurde. Der Kostenaufwand betrug 55 000 Mark, die
von der Sparkasse der Stadt Sendenhorst und des Amtes Vorhelm gegen Verzinsung und Überlassung der für ihren Betrieb notwendigen Büroräume zur Verfügung gestellt wurde.
In einfacher, ruhiger, monumentaler Form erhebt sich das neue Rathaus, das Haus der Bürgerschaft am Marktplatze als der stolze Nachbar der Stadtkirche, die dem Patrone, dem hl. Martinus, geweiht ist.
Sein Bild nach dem ältesten Stadtsiegel aus dem Jahre 1489, das in Soest aufbewahrt wird, vom Hofwappenmaler Hehling in Berlin entworfen, ziert das heutige Stadtwappen Sendenhorsts.
Erosionsschäden im Umlegungsgebiet
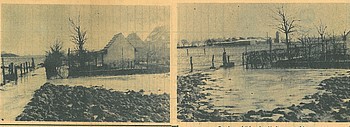 Bild:
Bild:
Abschwemmung des Lockerbodens am „Stofferskamp“ (links); angestautes Wasser in einem Auffanggraben am Prozessionsweg (rechts)
SENDENHORST Um Sendenhorster Umlegungsgebiet hat die Beseitigung von Vorflutern dazu geführt, daß an einigen Stellen fruchtbare Ackerstücke vom Wasser allmählich ausgelaugt werden.
Merkliche Veränderungen schaffte zudem die plötzliche Schneeschmelze.
Das abfließende Wasser gräbt Furchen und reißt Erde, Sand und kleine Steine mit. Es ist natürlich, daß gerade die feinen Humusteilchen ausgewaschen und weithin verschleppt werden. Um einer weiteren
Bodenerosion entgegenzuwirken, ist es daher notwendig, daß die Vorfluter wieder hergestellt und daß jetzt die Einmündungen der Beetfurchen mit dem Spaten freigehalten werden.
Das Kriegsende in Sendenhorst, aus der Betrachtung kurz nach 1945
Einiges würde heute, 70 Jahre nach Kriegsende, bestimmt anders geschrieben – So findet es sich in den Archiven… Man bedenke: Der Krieg war gerade erst zu Ende. In der Zeitung stand zu lesen: Die Russen stahlen wie die Raben - Frauen und Mädchen flüchteten vor farbigen Soldaten ...
 Sendenhorst Die letzten Tage des zweiten Weltkrieges wurden
in Sendenhorst eingeleitet mit dem Bemühen, aus den Reihen der Daheimgebliebenen einen Volkssturm aufzustellen, um die Stadt gegen die heranrückenden feindlichen Truppen verteidigen zu können.
Bereits in der großangelegten Versammlung im Hotel Bernhard Herweg wurde an der Möglichkeit des Erfolges der Volkssturmmänner gezweifelt und einige, die dabei gewesen waren, erinnern sich noch heute,
wie H. L. Vissing von dem Kampfkommandanten unter Androhung schwerer Strafen zurechtgewiesen wurde, als er auf die Sinnlosigkeit dieses Unternehmens hingewiesen hatte.
Sendenhorst Die letzten Tage des zweiten Weltkrieges wurden
in Sendenhorst eingeleitet mit dem Bemühen, aus den Reihen der Daheimgebliebenen einen Volkssturm aufzustellen, um die Stadt gegen die heranrückenden feindlichen Truppen verteidigen zu können.
Bereits in der großangelegten Versammlung im Hotel Bernhard Herweg wurde an der Möglichkeit des Erfolges der Volkssturmmänner gezweifelt und einige, die dabei gewesen waren, erinnern sich noch heute,
wie H. L. Vissing von dem Kampfkommandanten unter Androhung schwerer Strafen zurechtgewiesen wurde, als er auf die Sinnlosigkeit dieses Unternehmens hingewiesen hatte.
Bild: 1950 - Kindergarten St. Michael - Overbergstraße - Einweihung Pfarrer Heinrich Westermann, Küster Eberhard Haselmann, Meßdiener und Gäste
Trotzdem: Der Volkssturm wurde aufgestellt, Gruppenführer ernannt, die Einsatzorte festgelegt, und schließlich wurden die Männer auch in der Mühlenkuhle vereidigt. Uebungen mit Panzerfäusten wurden
auf dem Gelände der alten Sandgrube im Westen abgehalten. Es gab kaum Panzerfäuste, und bis zum Einzug der Amerikaner versagte auch der Nachschub, so daß der Einsatz des Volkssturms, der von den
Männern nicht sonderlich ernst genommen wurde, darin bestand, daß man am Westtor mit Hilfe der SA Panzersperren aufgebaut und später ohne SA wieder abgebaut hatte. Die letzte Versammlung der
Volkssturmmänner hatte am Gründonnerstag – 29. März – in der Nähe der Baracken der Gebietsführung in der Mühlenkuhle stattgefunden. Dabei, so erinnert sich ein Teilnehmer, wurde reichlich Alkohol
ausgeschenkt, um die Männer bei Laune zu halten.
Am Mittag des Karsamstags, kurz nach ein Uhr, fuhren die ersten Panzerspähwagen vom Westen her in die Stadt ein. Panzer folgten. Die von SA und Volkssturm errichtete Panzersperre war verschwunden,
doch aus den ausgehobenen Gräben soll das Feuer eröffnet worden sein. Durch amerikanische Geschosse sollen bei dem kurzen Gefecht nicht nur einige deutsche Soldaten getötet worden sein, sondern auch
einige russische Zivilarbeiter, die sich in einer Scheune verschanzt hatten und die von den Amerikanern zerschossen wurde. Bei einem weiteren Gefecht sind in der Bauerschaft Ringhöven acht
Hitlerjungen aus dem Recklinghauser Raum gefallen, als sie den Vormarsch der Amerikaner mit einer Panzerfaust aufzuhalten versuchten. Vier schöne alte Bauernhöhe, so schreibt Pfarrer Westermann in
der Pfarrchronik von St. Martini, gingen in Flammen auf: Ihre Namen sind: Ringhoff, Kalthoff, Greiwe und Middrup-Vornholz.
Die Übergabe der Stadt soll ohne Schwierigkeiten vor sich gegangen sein. Am Krankenhaus soll Pater Boesch den Amerikanern entgegengegangen sein, ein amerikanischer Offizier soll auch mit dem Bischof
von Münster, Clemens August Graf von Galen, im St.-Josefs-Stift verhandelt haben. Einzelheiten über dieses Gespräch sind nicht bekannt geworden, doch erinnert sich Pfarrer Westermann an eine
deutschsprachige Sendung von BBC-London vom 2. oder 3. April 1945, in der bekannt gegeben wurde, daß alliierte Truppen den Bischof von Münster, den „Löwen von Münster“, aufgefunden hätten. Er habe
aber den Fragen der ihn bestürmenden Kriegsreporter kaum eine Antwort gegeben, sie nicht gewürdigt und auch sonst kein Interview geben wollen. Er habe eine stolze Haltung gezeigt.
Die Panzer durchfuhren den Ort, einige bogen nach Hoetmar ab, andere nahmen Kurs auf Tönnishäuschen. In der Stadt wurden weiße Fahne gehißt als Zeichen der kampflosen Kapitulation. Einige Amerikaner
besetzten das Rathaus. Eberhard Haselmann, damals Angestellter bei der Verwaltung, wurde noch am Karsamstag zum Rathaus gerufen: Sämtliche Schränke waren aufgebrochen, die Fußböden mit Papieren und
Akten bedeckt. Ein amerikanischer Ortskommandant hatte inzwischen Dr. Schwermann zum Bürgermeister ernannt. Laufend wurden Bekanntmachungen über das Verhalten der Bürgerschaft erlassen und
vervielfältigt. So wurde eine Ausgangssperre von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens verhängt. Die Kommandantur setzte sich mit dem damaligen Pfarrer Westermann in Verbindung, um einen neuen
Bürgermeister zu ernennen. Mehrere wurden vorgeschlagen, doch lehnten sie das Amt ab. Schließlich wurde der pensionierte Oberinspektor Eugen Strothmann zum Bürgermeister, der auch die
Verwaltungsaufgaben zu erledigen hatte, ernannt. Ihm zur Seite stand eine Dolmetscherin. Auch eine zivile Polizei wurde aufgestellt. Wie in vielen Orten, so wurden auch in Sendenhorst die üblichen
Order erteilt: Alle Waffen abliefern, kein Kraftfahrzeug benutzen, Ausgehsperre!
„Die Besatzungstruppen“, so schreibt Pfarrer Westermann in der Pfarrchronik, „waren zumeist Amerikaner. Es muß ihnen nachgesagt werden, daß sie sich durchweg human betragen haben. Gewalttaten und
Plünderungen seitens der Truppen sind nur wenige bekannt geworden“. Zu diesen wenigen gehörten jedoch einige Ueberfälle farbiger Soldaten. Junge Mädchen und ältere Frauen wurden von Negern des Nachts
in betrunkenem Zustand überfallen, doch fanden die Frauen vom Stadtrand und aus den Bauerschaften einen Ausweg: Sie übernachteten auf dem Dachboden des Krankenhauses, wo sie vor den Soldaten in
Sicherheit waren.
Viel schlimmer als diese gelegentlichen Ueberfälle waren die Plünderungen und Gewalttaten der russischen Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter. Zu den in Sendenhorst untergebrachten Fremdarbeitern kamen
in den letzten Tagen vor dem Einmarsch der Amerikaner noch zahlreiche Zivilrussen und Polen, die in der Fabrik Dünnewald zwar nur eine Nacht übernachteten, die jedoch nicht mehr alle weitergeschleust
wurden. Sie wurden von der NS-Frauenschaft versorgt. Russen und Polen wurden im Arbeitsdienstlager bei Niestert und im alten Rathaus untergebracht. Für die Sendenhorster Bevölkerung begann eine
schreckliche Zeit. Die meisten Bauernhöfe wurden von den Russen – Männer und Frauen hatten sich zu Gruppen vereint – und Polen beraubt. Die ehemaligen Fremdarbeiter nahmen alles, was ihnen wertvoll
erschien. „Sie benahmen sich anmaßend und stahlen wie die Raben“, steht in der Pfarrchronik. Gebilligt wurden diese Gewalttaten von den Amerikanern nicht, sie bildeten auch keine Gemeinschaft mit den
Russen und Polen, doch konnten die Ueberfälle nicht unterbunden werden. Meist unternahmen die Russen ihre Streifzüge in betrunkenem Zustand, wie das auch in anderen Orten der Fall gewesen war.
Glücklicherweise verfügten die Sendenhorster Brennereien nur noch über kleinere Mengen Alkohol, da vom Wirtschaftsamt bereits vor dem Einmarsch der Truppen Alkoholgutscheine ausgegeben worden waren,
die Einheimischen mit Alkohol versorgt wurden und Sendenhorster Bürger später in dem allgemeinen Chaos mit großen Kannen den Alkohol nur noch literweise nach Hause gefahren hatten. Trotzdem wurden
viele Höfe ausgeplündert. Die Bauern hatten die Höfe nachts vielfach verlassen, um in der Stadt zu schlafen. Am Tage wurde sie oft ausgepreßt, beraubt und mißhandelt. An allen Wegen lauerten
Wegelagerer. Auch verschiedene Geistliche, die zu ihrem Bischof nach Sendenhorst wollten, wurden angefallen, ausgeplündert und verletzt. Diesem verbrecherischen Treiben sah die Besatzung oftmals
tatenlos zu, und oft soll das Militär beim Rauben und Plündern sogar geholfen haben. Dabei wurden Russen- und Polenlager von der Stadt mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen des täglichen Lebens
wie Betten, Kleidung, elektrischen Geräten versorgt. Diese Geräte mußten von Sendenhorster Familien oder den zahlreichen Evakuierten – etwa 1.000 – beschlagnahmt werden. Für die zivile Polizei war
das eine mehr als undankbare Aufgabe. Besonders von dieser Maßnahme betroffen wurden die ehemaligen Mitglieder der NSDAP. Viele Häuser mußten auch für die Besatzung geräumt werden. Dabei durften die
Bewohner nur die dringlichsten Gebrauchsgegenstände mitnehmen. Von einer Freiheit, die die Alliierten den Deutschen bringen wollten, konnte sicherlich nicht die Rede sein.
Zum Abschluß eine kleine Geschichte, die von Mut und Entschlossenheit des damaligen Pfarrers Westermann zeugt, wie sie ein Teilnehmer einer Beerdigung in Erinnerung hat: Ein junges Mädchen kam am
Krankenhaus mit seinem Fahrrad dem Trauerzug entgegen, als zwei Polen das Mädchen überfielen, um ihm das Fahrrad zu entreißen. Pfarrer Westermann – im weißen Rochett – mischte sich kurz entschlossen
in das Handgemenge ein und rettete dem Mädchen so das Fahrrad. Mit Flüchen und Beschimpfungen zogen sich die Polen grollend, jedoch unverrichteter Dinge, in das Lager zurück.
Sendenhorst vor 50 Jahren - im Jahr 1903
1903 - Einweihung des Bahnhofes. 1975 - Fahrt des letzten Pängel Anton - Reaktivierung des Personenverkehrs mit der WLE?
 SENDENHORST 1903:
SENDENHORST 1903:
25. Jan.: Krieger- und Landwehrverein Sendenhorst veranstaltete zum Geburtstag Sr. Majestät des Kaisers und Königs im Saal B. Horstmann eine theatralische Abendunterhaltung.
30. Jan.: Besitzung Klingelmann ging durch gerichtliche Versteigerung zum Preise von 9.500 M in den Besitz des Rentiers Hesselmann über.
3. Febr.: Stadtverordnetensitzung. Es soll eine Gebührenordnung betr. Erhebung von Abgaben bei Neu- und Umbauten erlassen werden. Ab 1.4. wurde eine obligatorische Fortbildungsschule ins Leben
gerufen.
4. Febr.: Die Schneidermeister von Sendenhorst beschlossen, den Arbeitslohn von 25 auf 30 Pf pro Stunde zu erhöhen, ferner Zutaten zu den mitgebrachten Stoffen nicht mehr anzunehmen, da dadurch viel
Unannehmlichkeiten entstehen. In dem einen Falle reichten die Zutaten nicht aus, in dem anderen Falle paßten sie nicht zu den Kleiderstoffen.
6. Febr.: Im Hotel Ridder fand eine Vorbesprechung zur Papst-Jubiläumsfeier (Leo XIII.) statt. Sendenhorst rüstete zur großen Papstfeier.
27. Febr.: Besitzung Levi Stern ging in den Besitz der Frau Wwe. Offers und die Besitzung der letzteren in den Besitz des Händlers Drüner über.
11. März: Jubiläumsfeier Sr. Heiligkeit Papst Leo XIII. im Horsmannschen Saale. Abends vorher Ankündigung des Festes durch Böllerschießen. Sonntags feierliches Levitenamt. Nachm. Te Deum, 4 Uhr
Festversammlung, 8 Uhr Fackelzug mit großem Brillantfeuerwerk.
21. April: Lehrer Caspar Möllers feierte unter reger Anteilnahme das Jubiläum seiner hiesigen 25jährigen Wirksamkeit. Ein Festtag. Heute nachm. lief der erste Transportzug der Bahn Neubeckum –
Münster, festlich bekränzt, in den hiesigen Bahnhof ein. Böllerschüsse wurden abgegeben, und eine Kapelle aus Wolbeck musizierte.
4. Mai: Die Synagoge mit einem Stück Gartenland wurde zum Preise von 2.320 M vom Metzgermeister Kaspar Haussen erworben.
13. Mai: Das Haus des Maurers Th. Schlüter ging zum Preise von 4.200 M in den Besitz des Th. Hurtig über, die Besitzung des Th. Hurtig zum Preise von 4.050 M in den Besitz des Schreinermeisters Anton
Mössing.
15. Mai: Einteilung der Wahlbezirke zur Reichstagswahl am 16. Juni: Sendenhorst Stadt – ganze Gemeinde (Seelenzahl 1.12.1900 = 1.889). Wahllokal Rathausbüro, Wahlvorsteher Bürgermeister Hetkamp,
Stellv.: Beigeordneter Silling. – Sendenhorst Kirchspiel – ganze Gemeinde (Seelenzahl 1.1.1900 = 842), Wahllokal Hotel Klümper, Wahlvorsteher: Gemeindevorst. Vornholz, Stellv.: stellv.
Gemeindevorsteher Werring.
28. Mai: Der 37 Jahre alte Viehwärter des Schulze zur Alst wurde beim Melken einer Kuh von einem Ochsen dermaßen gestoßen, daß dem Armen die Eingeweide aus dem Leibe kamen.
3. Juni: Einquartierung am 9. Juni vom 2. Westf. Feldart.-Regt. Nr. 22 in der Gemeinde Sendenhorst, 15 Off., 339 Mann und 215 Pferde mit Verpflegung und Fourage.
9. Juni: Krieger- und Landwehrverein feierte sein Stiftungsfest.
12. Juni: Zentrumsversammlung bei Horstmann.
15. Juni: Der Volksverein rief auf. Eine imposante Wahlversammlung für die Reichstagswahl im Horsmann-Saal. Vikar Beike eröffnete sie und Pastor Schroeder hatte das Wort. - Primizfeier der
Neupriester Joseph Freise und Anton Horstmann.
16. Juni: Wahlergebnis Stadt: Wahlberechtigt 422, gew. 279, Kirchspiel: Wahlberechtigt 181, gew. 102 – alle Zentrum.
22. Juni: Lt. Prämierungsliste der Handwerker-Ausstellung in Arnsberg erhielt W. Meyer den 4. Preis.
23. Juni: Beim Austragen eines Telegramms wurde der Brenner Kleinhans von einem Schlag getroffen und war gleich tot.
13. Juli: Der Allgemeine Schützenverein von Stadt und Land feierte sein Fest beim Wirt Austermann. Die Königswürde erwarb Kaufmann Heinr. Höne, Königin wurde Frau Aug. Pottmeyer.
17. Juli: Schweres Gewitter. Blitz schlug in die Scheune des Brauereibesitzers Wieler ein.
24. Juli: Die Hoetmarer Chaussee ist fertiggestellt. – Mit dem Mähen des Roggens wurde begonnen.
28. Aug.: Stärkeres Auftreten der Typhus-Krankheit.
16. Sept.: Bekanntmachung zur Einweihung der Westf. Landeseisenbahn Neubeckum – Münster
18. Sept.: Die Abnahme der Bahn ist erfolgt. Die Einweihung der neuen Strecke erfolgt am 30.9.
23. Sept.: Rektor des hiesigen St.-Joseph-Stiftes Franz Schröder ist im Alter von 61 Jahren entschlafen.
23. Sept.: Vor dem Ertrinken wurde das dreijährige Söhnchen des Schuhmachermeisters Bernh. F. im Stadtgraben von der Frau B. gerettet.
23. Sept.: Zwecks Ausschmückung der Stadt zur Einweihung der neuen Bahn fand eine Versammlung bei Klümper statt.
25. Sept.: Fahrpreis der neuen Bahn nach Münster 3. Kl. 0,90, hin und zur. 1,30, 2. Kl. hin und zurück 1,90.
30. Sept.: Zum Viehmarkt waren aufgetrieben ca. 50 Stück Rindvieh, Absatz zum Preise von 240 – 400 M. Schweinehandel flauer Auftrieb, 150 Stück.
30. Sept.: Sendenhorst im reichen Flaggenschmuck. Feierliche Eröffnung der neuen Bahn. Mit einem Sonderzug, der mit grünen Zweigen und bunten Fähnchen geschmückt war, fuhren die Festteilnehmer von
Münster nach Neubeckum. Ueberall wurden die Festteilnehmer mit Böllerschüssen begrüßt. Von Neubeckum ging es dann um 11 Uhr 40 zurück. Auf der Station Sendenhorst sprach Bürgermeister Hetkamp. Die
Festgäste blieben 40 Minuten lang zur Einnahme des Frühstücks hierselbst. 500 Butterbrote waren in fünf Minuten vergriffen. Nicht minder wurden die verschiedenen Fässer Bier im Angesichte der
sengenden Sonnenglut leergetrunken. Auch der berühmte Sendenhorster Korn fehlte nicht. Um 7 ½ Uhr langte der Zug wieder auf unserer Station an, wo abermals ein festlicher Empfang stattfand. Vom
Bahnhof aus wurde unter Vorantritt einer eigens engagierten Kapelle ein Fackelzug veranstaltet. Einen würdigen Abschluß fand die Feier im Saale des Herrn B. Schramm durch einen Kommers, der die
Teilnehmer bis zum frühen Morgen in der fidelsten timmung beisammen hielt.
1. Okt.: Die neue Eisenbahnstrecke wurde so stark von Fahrgästen in Anspruch genommen, daß die Züge sich bedeutend verspäteten.
5. Okt.: Am ersten Tage wurden befördert nach Albersloh 19 Personen, Alst 8, Angelmodde 167, Enniger 6, Neubeckum 89, Sendenhorst 28 und 2 Hunde, Tönnishäuschen 8, Wolbeck 138 und 10 Hunde,
Ennigerloh 11, Liesborn 2 und Wadersloh 1, zusammen 477 Personen und 12 Hunde.
9. Okt.: Das Haus des Küfers Herm. Kerkmann (Preis 2.100 M.) ging in den Besitz des Jos. Bartmann über, das Haus des Th. Börger (2.700) in den Besitz des Webers Werner Saerbeck.
16. Okt.: Stadtverordnetenversammlung. Gratisabgabe von Sand aus städtischen Sandgruben soll nicht mehr erfolgen. Ueber die Anlage eines neuen Friedhofes teilten sich die Meinungen, ob sich die
Anlegung eines politischen oder konfessionellen Friedhofes empfiehlt.
20. Okt.: Stadtverordnetensitzung. Man entschied sich für die Anlegung eines konfessionellen Friedhofs. Dem Antrag Löckmann auf Anlage einer Waage wurde zugestimmt. Kasp. Becklas wurde als
Desinfektor gewählt. Von der Anlage eines „Verschönerungsplatzes“ wurde Abstand genommen. Die Frage der Errichtung einer Handnähschule wurde zurückgestellt.
21. Okt.: Mehrere Züge Kraniche zogen gen Süden.
30. Okt.: Fräulein Lehrerin Van Roschee feierte ihr 25jähriges Dienstjubiläum.
6. Nov.: Versammlung des Westf. Bauern-Vereins mit Gründung einer Bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft. In den Vorstand wurden gewählt: Rothkötter als Vors., Middelhove stellv. Vors.,
Beisitzer Isfort, Kleine Westhoff-Schotte und Vrede. In den Aufsichtsrat: Th. Horstmann, Vors., B. Roetering, stellv. Vors. Beisitzer: Vornholz, Roeper, Westhues und Hesse.
18. Nov.: Wilh. Bischob erhielt auf der 2. Geflügel-Ausstellung in Herne für seine selbstgezüchteten Schaubrieftauben die Staatsmedaille und den 1. Preis.
20. Nov.: In der Versammlung bei Jönsthövel wurde Edmund Panning als Rendant und Lagerhalter der Bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft gewählt.
25. Nov.: Stadtverordnetensitzung. Verkauf städt. Grundbesitzes soll durch öffentliche Ausschreibung erfolgen. Kollegium genehmigte die Anfertigung eines Fluchtlinienplanes. Für die Bepflanzung
öffentlicher Wege soll vorerst ein sachverständiges Urteil eingeholt werden. Die Pflasterung des Trottoirs zum Bahnhof soll vorgenommen werden, ebenso die Ausbesserung der Kühlstraße und die
Chaussierung am Osttor. Es soll ein Ortsstatut über die Quartierleistung für die bewaffnete Macht erlassen werden. Die 16.000 M. Sparkassenüberschüsse wurden auf den Etat übernommen.
2. Dez.: Stadtverordnetenwahl. 3. Abt. 244 Wahlber. 131 übten ihr Stimmrecht aus. Es entfielen auf Heinrich Beumer 57, Franz Pälmke 60, Jos. Bartmann 14. 2. Abt. 50 Wahlberechtigte, 34 wählten. Es
entfielen auf Bernh. Klümper 23, Kupfermaaß 11, 1. Abt. Von den 11 Wahlberechtigten wählten alle Th. Wieler.
22. Dez.: Stadtverordneten-Stichwahl der 3. Abt. 157 Wähler, davon entfielen auf Heinr. Beumer 91, Franz Pälmke
66.
Sendenhorst ungeteilt bis vor 100 Jahren - Stadtdirektor Esser zur Geschichte von Stadt und Land Sendenhorst
In der Bürgerschaftsversammlung der Gemeinde Kirchspiel Sendenhorst am Dienstag im Saale Werring gab Stadtdirektor Esser namens der Verwaltung der Stadt Sendenhorst einen umfangreichen Bericht, der u. a. wertvolle Hinweise auf die Geschichte von Sendenhorst enthielt und in dem das gemeinsame Schicksal der Stadt und des Kirchspiels im Laufe der Jahrhunderte vor dem Jahre 1851 seinen Niederschlag fand.
Sendenhorst „Die Glocke“ veröffentlicht diesen Auszug aus dem Bericht des Stadtdirektors mit der
ausdrücklichen Erklärung, sich damit in keiner Weise mit einer Seite der beiden Parteien identisch zu fühlen, die sich im Disput um die Zukunft des Kirchspiels Sendenhorst befinden.
Bild:
Amtshof Wolbeck
„In den Heberegistern der alten Klöster, vornehmlich der Abtei Werden und des Klosters Freckenhorst, das im Jahre 851 gegründet wurde, wird Sendenhorst schon um das 9. Jahrhundert erwähnt. Zahlreiche
Höfe der Sendenhorster Gegend hatten den alten Klöstern Gefälle zu entrichten. Auch die Namen der zu Sendenhorst gehörenden Bauernschaften finden wir in den genannten alten Klosterheberollen. Der
Name Rinkhove bezeichnete ursprünglich nur einen Hof, der in der Bauerschaft Schorlemer lag. Später ist der Name Schorlemer als Bauerschaftsname verschwunden und an seine Stelle Rinkhove getreten.
Die Namen fast aller Bürgermeister von Stadt und Kirchspiel sind seit Ende des 16. Jahrhunderts noch bekannt. Sie entstammten angesehenen Bürgerkreisen. Ihnen standen zur Seite die Ratsherren, ein
Sekretär, ein Gemeindeempfänger und ein Gemeindediener. Die Bürgermeister verwalteten ihre Gemeinde ehrenamtlich und wurden alljährlich neu gewählt und nach der Wahl vor dem Gericht zu Sendenhorst
auf dem Rathaus vereidigt. Sie hatten aber keine Stimmrechte bei den Sitzungen des Gerichts. Der Sekretarius, der ebenfalls gewählt und vereidigt wurde, hat für die Bürgermeister die schriftlichen
Arbeiten zu erledigen. Die Bürgermeister waren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit verantwortlich, hatten Musterungen zu leiten, Verbesserungen von Wegen, Abwässerungen u.a.m. durchzuführen.
Beide Gemeinden mit ihren Bürgermeistern haben in den Jahrhunderten seit ihrem Bestehen immer fest zusammengestanden und die Not aller Zeiten mit gemeinsamer Kraft überstanden.
So berichtet uns die Geschichte von Sendenhorst, daß die unruhevollen Zeiten des ausgehenden Mittelalters, die religiösen Wirren der Reformation, die auch an die vom hl. Martinus beschützten Mauern
Sendenhorsts ihre Wellen geschlagen hat, die Zeiten, da vor etwa 400 Jahren die Wiedertäufer ihre Herrschaft in Münster gewannen und verspielten, die furchtbaren Jahrzehnte des Dreißigjährigen
Krieges, der Einfall der Spanier (1628) und Hessen (1637), die harten Unglücksjahre des Siebenjährigen Krieges und der napoleonischen Fremdherrschaft. Zeiten von Not und Tod, die Sendenhorst erlebt
hat, da immer wieder die feindlichen Mächte im Lande standen und wie Wilde plündernd und mordend die ganze Gegend unsicher machten. Sorgenvoll kamen dazumal die Ratsherren unter ihren beiden aus der
Bürgerschaft gewählten Bürgermeistern in der Ratsstube zusammen, um zu beraten, wie sie die Lasten der Besatzung tragen und wie sie die Habe der Bürger schützen könnten. Um 1800 gehörte Sendenhorst
mit Stadt und Kirchspiel, ebenso wie die meisten Gemeinden des heutigen Kreises Beckum, zu dem fürstbischöflichen Amte Wolbeck, dem größten Amtsbezirk des Hochstiftes unter Leitung eines Amtsdrosten.
Im Jahre 1806, kurz nachdem in Münster zur Neuregelung der Verhältnisse eine Kriegs- und Domänenkammer (heute Bezirksregierung genannt) errichtet wurde, rückten infolge der für Preußen unglücklichen
Doppelschlacht von Jena und Auerstädt Napoleons Truppen im östlichen Münsterland ein. Die Geschicke von Sendenhorst lagen damals in der Hand des Bürgermeisters Langen, der nun nach französischer
Besatzung als „Maire“ betitelt wurde. Die Stadt, Feldmark und das Kirchspiel Sendenhorst bildeten zu der Zeit ein einziges politisches Gemeinwesen. Im Jahre 1808 trat sodann Napoleon das Fürstbistum
Münster mit dem ehemaligen Amte Wolbeck seinem Schwager, dem Großherzog Joachim von Berg, ab. Das ganze Land wurde in Departements (heute etwa Regierungsbezirke), Kantone (heute etwa Kreise) und
Mairen (Bürgermeistereien) eingeteilt. Sendenhorst wurde dem Ruhrdepartement Dortmund angegliedert und gehörte zum Arrondissement Hamm und Kanton Ahlen. Maire war Langen und die Munizipalräte
(Gemeinderäte) waren: v. Rhemen (Kspl. Sendenhorst), Silling (Stadt oder Kspl.), Sulzer (Stadt), Arnemann (Kspl.), Silling (Stadt oder Kspl.) und Angelkotte (Kspl.).
Die große Völkerschlacht bei Leipzig im Jahre 1813 machte der französischen Fremdherrschaft ein Ende. Preußen kam wieder in den Besitz des Münsterlandes. Der sogenannte Zivilgouverneur (später
Oberpräsident), Freiherr von Vincke, besorgte nunmehr die Neuordnung der Verhältnisse. Zu Vinckes bedeutenden Maßnahmen gehörte die Neueinteilung nach Kreisen. Sendenhorst kam in den Kreis Beckum,
und der Bürgermeister Langen führte in Sendenhorst die Verwaltungsgeschäfte bis 1820 weiter. Ihm folgten bis 1822 Regierungsrefrendar von Westhoven, bis 1824 Bürgermeister Röhr und von 1825 bis 1833
Bürgermeister Markus. Aus unbekannten Gründen übernahm dann Amtmann Johann Heinrich Brüning die Verwaltung, der seit 1815 das Amt Vorhelm betreute. 1840 schied nun Amtmann Johann Heinrich Brüning aus
der Verwaltung aus. Sein Sohn, Franz Brüning, der in Sendenhorst wohnte und als Bürogehilfe bei der Stadtverwaltung tätig war, wurde nun Bürgermeister und übernahm gleichzeitig die Amtsverwaltung
Vorhelm. Er zog auf den elterlichen Hof in Enniger. Beide Verwaltungsstellen befanden sich nun wieder in der Hand eines Brüning, in diesem Falle in der Hand des Franz Brüning, des späteren
Ehrenamtmannes. In einer Bekanntmachung des Regierungsblattes vom 23.8.1840 heißt es wie folgt: Die Verwaltung der Bürgermeisterei Sendenhorst und Vorhelm wird dem bisherigen Bürogehilfen Franz
Brüning kommissarisch übertragen. Als dann im Jahre 1851 für Sendenhorst wieder ein eigener Bürgermeister eingesetzt wurde, befürchtete das Kirchspiel, den Amtmann Brüning zu verlieren. Danach muß zu
der damaligen Zeit die Persönlichkeit des Brüning gerade für die Kirchspielgemeinde besonders bedeutungsvoll gewesen sein.
Es liegt nahe, anzunehmen, daß die Bevölkerung des Kirchspiels ihre bäuerlichen Interessen bei dem Bürgermeister Brüning, der in Enniger selbst einen großen Hof hatte, am besten gewahrt sah und sich
diesem angeschlossen hat. In einer Bekanntmachung des Regierungsamtsblattes vom 14.10.1852 heißt es: Mit Bezug auf die Bestimmung des §156 der Gemeindeordnung vom 11.3.1850 wird hiermit
bekanntgemacht, daß die Einsetzung des Gemeindevorstandes in der Stadt Sendenhorst am 28. d. M. erfolgen, mithin die Einführung der Gemeindeordnung an dem gedachten Tage dort beendigt sein wird. Es
sind gewählt und bestätigt worden: 1. der seitherige Amtmann Kreishage aus Everswinkel zum Bürgermeister, 2. der Seilmachermeister Hermann Tawidde aus Sendenhorst zum Beigeordneten. damit tritt nun
die verwaltungsmäßige Trennung von Stadt und Kirchspiel ein. Dieser Zustand besteht nun etwa 100 Jahre. Zweifellos ist Sendenhorst in dieser Beziehung ein einmaliger Fall. Die Aufgaben der damaligen
Verwaltung lassen sich wohl mit den Aufgaben der heutigen Verwaltung nicht mehr vergleichen. Auch die Zahl der Einwohner hat sich im Laufe dieser 100 Jahre grundlegend geändert. Die Stadt Sendenhorst
hatte damals 1800 Einwohner (heute 4000), das Kirchspiel etwa 800 (heute 1910), Enniger etwa 1400 (heute 2400), Vorhelm etwa 1100 (heute 2500).“
Zeugen der Kreidezeit aus dem Kreise Beckum
Im Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Münster befinden sich als versteinerte Reste von Meerestieren der Kreidezeit die "Sendenhorster Fische". Mit besonderer Freude bringen wir den folgenden Kalenderbeitrag aus der Feder von Kustos Dozent Dr. Siegfried über diese für die Wissenschaft wie für die Heimatkunde gleich bedeutenden Funde.
S endenhorst Zum heutigen Landschaftsbild des Kreises Beckum gehören
seine zahlreichen Steinbrüche, die mit den Zement- und Kalkwerken der Steinindustrie in Verbindung stehen. In über 60 großen Brüchen kann man die wohl geschichteten Bänke von
Mergelkalkstein mit den Zwischenlagen von grauem Mergel in großer Regelmäßigkeit viele Kilometer weit verfolgen. Sie gewähren uns einen Einblick in eine weit
zurückliegende Zeit aus der Geschichte der Erde.
endenhorst Zum heutigen Landschaftsbild des Kreises Beckum gehören
seine zahlreichen Steinbrüche, die mit den Zement- und Kalkwerken der Steinindustrie in Verbindung stehen. In über 60 großen Brüchen kann man die wohl geschichteten Bänke von
Mergelkalkstein mit den Zwischenlagen von grauem Mergel in großer Regelmäßigkeit viele Kilometer weit verfolgen. Sie gewähren uns einen Einblick in eine weit
zurückliegende Zeit aus der Geschichte der Erde.
Abb. 1.a: Rostrum des Belemniten Belemnitella mucronata. b: Rekonstruktion eines Belemniten-Tieres nach 0. Abel.
Im Vergleich mit dem Alter des Menschengeschlechts hat unsere Erde ein ungleich höheres Alter, das nach Hunderten von Millionen Jahren zählt. Im Laufe dieser langen
Erdgeschichte wechselten auch im westfälischen Raum Zeiten ausgedehnter Meeresbedeckung mit Zeiten vorwiegenden Festlandes, wie auch Zeiten intensiver Gebirgsbildung mit
Zeiten verhältnismäßiger Ruhe der Erdkruste.
Eine Zeit weiter Meeresbedeckung war die Kreidezeit, vor rund 60 - 100 Millionen Jahren, so benannt nach dem auffallendsten Gestein, das sich damals gebildet hat, der
Schreibkreide, wie sie heute noch z. B. auf der Insel Rügen anzutreffen ist. Zu den Ablagerungen der Kreidezeit zählen aber auch die Kalke und Mergel des Münstersehen Beckens, zu
denen im besonderen auch das Gestein im Kreise Beckum gehört. Die Schichtung und horizontale Lagerung des Gesteins läßt uns erkennen, daß wir es hier mit Absätzen
eines Meeres zu tun haben. Ein toniger, zu Zeiten auch kalkreicher Schlamm am Meeresgrunde erhärtete und wurde nach Rückzug des Meeres am Ende der Kreidezeit zum festen
Gestein. Zeugen dafür, daß es sich hierbei tatsächlich um eine einstige Meeresbildung handelt, sind die im Gestein erhalten gebliebenen, versteinerten Reste von Meerestieren.
Sie zeigen uns aber auch, daß im Kreidemeer eine andersartige Tierwelt vertreten war, als wir sie aus den heutigen Meeren kennen. Vielerlei Familien, Gattungen und Arten
der Tiere der damaligen Zeit sind heute ausgestorben, und wir können nur aus den wenigen versteinert erhalten gebliebenen Hartteilen ihres Körpers ihr einstiges Lebensbild
wiederherstellen.
 Da finden wir zunächst rund 10 cm lange, an einem Ende zugespitzte,
fingerförmige Gebilde aus kristallinem Kalk, im Volksmund als "Donnerkeile" bekannt, die als Bestandteile des Körpers eines Tintenfisches zu deuten sind. Diese im allgemeinen
als Belemniten bezeichneten Tiere besaßen einen langgestreckten Körper, der in einem Hautsack die inneren Organe einschließlich eines Tintenbeutels barg und an seinem Kopf sechs
mit Haken besetzte Fangarme stehen hatte. Als Stützskelett lag im Inneren des Hautsacks eine kalkige Scheide, die nach hinten in einen soliden Sporn (Rostrum) ausgezogen
war. Dieser Teil ist es, der meistenteils allein als Versteinerung erhalten bleibt. (Abb. 1.) Die Belemniten sind aus allen Formationen des Erdmittelalters in einer großen
Anzahl verschiedenartiger Formen bekannt. Die in den Kreidekalken von Beckum vorkommende Art Belemnitella mucronata) ist kennzeichnend für die jüngeren Schichten
der Oberkreide (Ober-Campan).
Da finden wir zunächst rund 10 cm lange, an einem Ende zugespitzte,
fingerförmige Gebilde aus kristallinem Kalk, im Volksmund als "Donnerkeile" bekannt, die als Bestandteile des Körpers eines Tintenfisches zu deuten sind. Diese im allgemeinen
als Belemniten bezeichneten Tiere besaßen einen langgestreckten Körper, der in einem Hautsack die inneren Organe einschließlich eines Tintenbeutels barg und an seinem Kopf sechs
mit Haken besetzte Fangarme stehen hatte. Als Stützskelett lag im Inneren des Hautsacks eine kalkige Scheide, die nach hinten in einen soliden Sporn (Rostrum) ausgezogen
war. Dieser Teil ist es, der meistenteils allein als Versteinerung erhalten bleibt. (Abb. 1.) Die Belemniten sind aus allen Formationen des Erdmittelalters in einer großen
Anzahl verschiedenartiger Formen bekannt. Die in den Kreidekalken von Beckum vorkommende Art Belemnitella mucronata) ist kennzeichnend für die jüngeren Schichten
der Oberkreide (Ober-Campan).
Abb. 2 – oben Ammonit Hoplitoplacenticeras dolbergense, gefunden in Beckum.
Abb. 3 – unten Muschel Inoceramus balticus, gefunden in Ennigerloh.
Andere Meeresbewohner jener Zeit, die zur gleichen Tierklasse der Kopffüßler gehören, waren die Ammoniten. Ihr in der Regel in eine enge Spirale eingerolltes Gehäuse erinnert im
äußeren Bild an flache Schneckengehäuse, besteht aber aus einer Anzahl von luftgefüllten Kammern, die dem Weichtier, das die letzte Kammer bewohnte, die Möglichkeit gaben, in
allen Tiefenlagen schwimmend, sich leicht in der Schwebe zu halten. Über die Weichteile der Ammoniten ist uns nichts bekannt. Wir dürfen aber annehmen, daß sie entsprechend dem
ähnlich organisierten "Schiffsboot" (Nautilus), der heute noch im Indischen Ozean lebt, mit Fangarmen am Kopf und einem muskulösen Hauttrichter als Schwimmorgan aus Lebens
gerüstet waren. Das erhaltungsfähige Gehäuse der Ammoniten war in vielfältiger Weise durch Rippen, Streifen oder Knoten verziert, die den Formen der einzelnen Zeitabschnitte ihr
charakteristisches Gepräge gaben.
Die Ammoniten des Kreidemeeres erreichten häufig beträchtliche Größen. In den Kalken des Beckumer Raumes sind sie nicht sehr häufig vertreten, jeder Fund eines Ammoniten ist
daher von besonderem Interesse. (Abb. 2.)
Eine große Muschel (Inoceramus balticus) kennzeichnet fernerhin die Lebewelt des Meeres der jüngeren Kreidezeit. Resten ihrer Schalen kann man häufig in den Kalkplatten begegnen.
Erhalten geblieben sind allerdings meist nur Abdrücke im Stein, die zarten Schalen selbst zerfallen schnell aus durch die Witterungseinflüsse. (Abb. 3.)
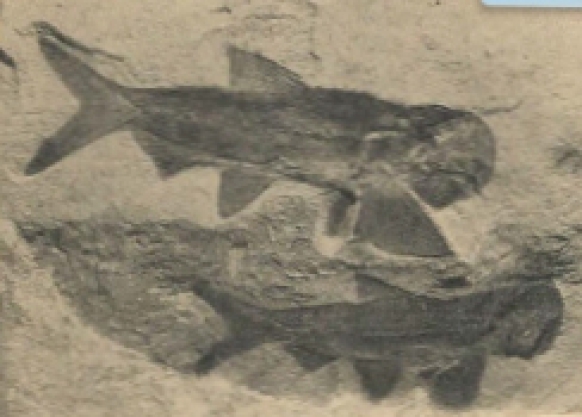 Die festen Gehäuse von Seeigeln und Meeresschnecken, aber auch das
zarte Gewebenetz von Schwämmen sind immer wieder im Kalkstein versteinert erhalten und beweisen uns, daß das Meer der Kreidezeit ähnliche Lebensbedingungen bot, wie man sie heute
in einem flachen, küstennahen Meer vorfindet.
Die festen Gehäuse von Seeigeln und Meeresschnecken, aber auch das
zarte Gewebenetz von Schwämmen sind immer wieder im Kalkstein versteinert erhalten und beweisen uns, daß das Meer der Kreidezeit ähnliche Lebensbedingungen bot, wie man sie heute
in einem flachen, küstennahen Meer vorfindet.
Abb. 4 Heringartiger Fisch (Histiothrissa macrodactyla), gefunden bei Sendenhorst.
Jedoch nicht für alle Meerestiere waren die Erhaltungsbedingungen gleich günstig. Die Fische, die zweifellos auch im Kreidemeer in großer Zahl verbreitet waren, fehlen dem
heutigen Kreidegestein weitgehend. Nur in einzelnen Lagen finden sich kleine spitze Zähne zusammengeschwemmt, die sich dank dem festen Zahnschmelz im Gestein erhalten haben
und Kunde davon geben, daß zur Kreidezeit auch mehrere Arten von Haien im Meere lebten. Und besonders günstigen Umständen ist es zu verdanken, daß wir in der Gegend von
Sendenhorst in beträchtlicher Anzahl vollständige Fischskelette in bester Erhaltung im Gestein finden können.
Schon vor über hundert Jahren wurde in der Umgebung von Sendenhorst, in den Bauerschaften Bracht, Ahrenhorst und Rinkhöven, in mehreren Steinbrüchen der Kalkstein
gewonnen. Hierbei kamen teils vereinzelt, teils nesterweise gehäuft Abdrücke von Fischen zutage, wie sie in den Kreideablagerungen sonst äußerst selten anzutreffen sind. Die
Steinbrüche bei Sendenhorst sind heute aufgelassen, bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts aber wurden hier wie auch in den gleichen Schichten in den Baumbergen westlich von
Münster zahlreiche Funde von Fischen gemacht, die uns eine gute Übersicht über die Fischfauna der Kreidezeit vermitteln. Die Mannigfaltigkeit der Formen ist groß. Da gibt es
heringartige Fische mit schlankem Körper und großen Flossen, die wohl auch schon zur Kreidezeit in Schwärmen das Meer durchzogen. Abb. 4 zeigt eine Gesteinsplatte mit 1.wei
wohlerhaltenen Exemplaren der Art (Histiothrissa macrodactyla). Zu den Stachelflossern gehören Fische mit hohem, gedrungenem Körper, die als langsame Schwimmer ruhige
Meeresbereiche aufsuchten.
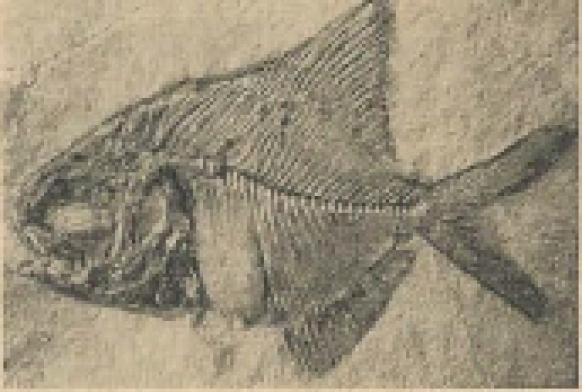 Die in
Abb. 5 (links) abgebildete Art (Platycormus germanus) ist nur aus den Kreideablagerungen Westfalens bekannt. Dagegen zeigt ein anderer seltener Fund von Sendenhorst (Abb. 6 -
rechts) einen kleinen, schlanken Fisch mit übermäßig verlängerten, fein bezahnten Kiefern, die einer Stoßlanze vergleichbar sind. Er ist als schneller Schwimmer und
Räuber der Hochsee anzusehen (Rhinellus furcatus). Noch mehrere Raubfische sind unter den Funden von Sendenhorst vertreten.
Die in
Abb. 5 (links) abgebildete Art (Platycormus germanus) ist nur aus den Kreideablagerungen Westfalens bekannt. Dagegen zeigt ein anderer seltener Fund von Sendenhorst (Abb. 6 -
rechts) einen kleinen, schlanken Fisch mit übermäßig verlängerten, fein bezahnten Kiefern, die einer Stoßlanze vergleichbar sind. Er ist als schneller Schwimmer und
Räuber der Hochsee anzusehen (Rhinellus furcatus). Noch mehrere Raubfische sind unter den Funden von Sendenhorst vertreten.
Abb. 5 Stachelflosser Platycormus germanus, gefunden bei Sendenhorst
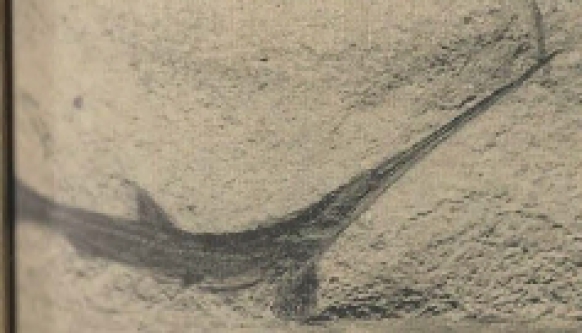 Abb. 6 Raubfisch Rhinellus furcatus, gefunden
bei Sendenhorst
Abb. 6 Raubfisch Rhinellus furcatus, gefunden
bei Sendenhorst
Ein prachtvoll erhaltenes Exemplar stellt einen starken Raubfisch von 45 cm Länge mit großen Flossen dar, seine Kiefer sind mit langen, spitzen
Zähnen bewehrt (Enchodus gracilis).
Ein anderer Raubfisch, von dem nur zwei Exemplare bekannt sind, die in
Sendenhorst gefunden wurden, hatte einen aalförmig langgestreckten Körper und einen gedrungenen Kopf mit starkem Gebiß (Palaeolycus dreginensis).
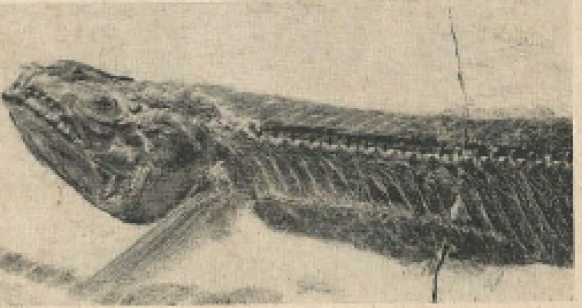 Im Magenraum des
in Abb. 8 abgebildeten Exemplars ist die Wirbelsäule eines kleinen Beutefisches erhalten geblieben, wodurch die räuberische Art seiner Lebensweise bestätigt wird. Diese
Fische der Kreidezeit gehören durchweg heute nicht mehr lebenden Gattungen an. Bei ihrem Vergleich mit den heutigen Meeresfischen fällt auf, daß der größte Teil von ihnen in
ihrem Körperbau und ihrer Organisation heutigen Tiefseefischen nahesteht.
Im Magenraum des
in Abb. 8 abgebildeten Exemplars ist die Wirbelsäule eines kleinen Beutefisches erhalten geblieben, wodurch die räuberische Art seiner Lebensweise bestätigt wird. Diese
Fische der Kreidezeit gehören durchweg heute nicht mehr lebenden Gattungen an. Bei ihrem Vergleich mit den heutigen Meeresfischen fällt auf, daß der größte Teil von ihnen in
ihrem Körperbau und ihrer Organisation heutigen Tiefseefischen nahesteht.
Die Kalksandsteine von Sendenhorst, in denen sie gefunden wurden, sind jedoch typische Bildungen eines flachen, küstennahen Meeres. Wir müssen daher annehmen, daß die Fische einen
anderen Lebensraum hatten und hier im Flachmeer nur ihren Begräbnisort fanden. Ihr seltenes Vorkommen spricht ebenfalls dafür. Man kann sich wohl vorstellen, daß die Fische
durch veränderte Meeresströmungen und durch Stürme aus ihrem eigentlichem Lebensbereich in der Hochsee gerissen wurden und ins Flachmeer verschlagen wurden, wo sie zugrunde gehen
mußten. Hier wurden sie dank einem schnellen Absatz von lockerem Sand- und Tonmaterial, wie er aus den Wattenmeeren bekannt ist, ohne Zerstörung auf dem Meeresgrunde eingebettet
und liegen uns dadurch heute in so schöner Erhaltung im Gestein vor. In mehreren Veröffentlichungen hat W. von der Marck in den .Jahren 1858 - 1894 die Fische von Sendenhorst
beschrieben. Die Originale zu den hier abgebildeten Stücken werden in den Sammlungen des Geologisch-Paläontologischen Instituts der Universität Münster aufbewahrt.
Der rote Hahn in Sendenhorst - Über wirklich alle Brände bis 1949
Unsere Heimatstadt hatte in dem letzten Kriege das Glück, von den sinnlosen Zerstörungen verschont zu bleiben. Indes kennt die Geschichte unserer Heimat genug des Leides, das in all den Jahrhunderten durch Feuersnot über unsere Gemeinde immer wieder hereingebrochen ist.
S endenhorst Unsere Heimatstadt hatte in dem letzten Kriege das Glück, von den sinnlosen
Zerstörungen verschont zu bleiben. Indes kennt die Geschichte unserer Heimat genug des Leides, das in all den Jahrhunderten durch Feuersnot über unsere Gemeinde immer wieder hereingebrochen
ist.
endenhorst Unsere Heimatstadt hatte in dem letzten Kriege das Glück, von den sinnlosen
Zerstörungen verschont zu bleiben. Indes kennt die Geschichte unserer Heimat genug des Leides, das in all den Jahrhunderten durch Feuersnot über unsere Gemeinde immer wieder hereingebrochen
ist.
1930 - Feuerwehrkapelle auf dem Marktplatz - Aktuell 2015: Achtung Baustelle ! ;-)
Die dichtgedrängte Siedlungsweise des Mittelalters, auch der Neuzeit noch, und vor allem die Bauweise selbst ist der wesentliche Grund dafür, daß oft eine kleine Unvorsichtigkeit schnell einen
Brandherd schuf und furchtbare Katastrophen über die Stadt oder einzelne Viertel heraufbeschwor. So sehr auch das städtische Gemeinwesen vorsichtig und umsichtig die Organisation einer Feuerhilfe
ausbaute und in der städtischen Verfassung die Pflicht zur Brandbekämpfung und die Beschaffung entsprechender Hilfsmittel, wie Feuereimer, Feuerhaken jedem neuen, das Bürgerrecht erwerbenden
Mitbürger auferlegte, so blieb doch alles nur eine unzulängliche Vorsichtsmaßnahme. Die beieinander liegenden Wohnstätten waren bekanntlich Fachwerkhäuser, und schnell fraß sich insbesondere in den
Sommermonaten das Feuer durch Balken und Lehmwände zur Nachbarschaft durch, wenn nicht schneller noch bei Sturm oder einer ungünstigen Windrichtung die sprühenden Flammen und brennende Holzscheite
immer neue Brände entzündeten.
Wenn wir in den Annalen unserer Heimatgeschichte lesen, so sind Pest, Krieg und Teuerung, die Brände in all den Jahrhunderten eine wahre Geißel für unsere Vorfahren gewesen, und aus der Kenntnis
vergangener Zeiten vermögen wir um so besser zu begreifen, wie sehr doch neuzeitliche Bauweise und technische Fortschritte einer modernen Feuerbekämpfung das feuergefährdete Leben, Hab und Gut immer
mehr gesichert und geschützt haben.
In zeitlicher Folge mögen die Feuerschäden unserer Heimatstadt hier aufgezeichnet werden und uns Not und Jammer der zahlreich Betroffenen, aber auch immer wieder ihren unverzagten Lebensmut vor Augen
führen, der aus Ruinen eine neue Zukunft baute.
1323: Nach den urkundlichen Berichten die erste Brandkatastrophe
23. Okt. 1529: An diesem Tage brannte die ganze Stadt mit Ausnahme einiger Häuser im Süden und Westen innerhalb zweier Stunden völlig nieder. Auch der Turm der Kirche wurde zusammen mit fünf Glocken
vom Feuer zerstört.
3. Nov. 1639: eine große Feuersbrunst, die den Stadtteil zwischen dem Nord- und Osttor ergriff und ihn mit Ausnahme weniger Häuser in Asche legte. Etwa 80 Häuser brannten nieder.
29. Dez. 1650 entstand auf der Südstraße ein Brand, der 50 Häuser einäscherte. Auch das Rathaus ging in Flammen auf.
1666 brannten 18 Häuser nieder.
1746 brannte das Haus des Schmiedes Hermann Bering.
19. Sept. 1749: eine Feuersbrunst, die zu den größten zählt, die Sendenhorst jemals getroffen hat. Auch das Pfarrhaus wurde ein Raub der Flammen und mit ihm, neben dem größten Teil der Ernte, noch
die Hinterlassenschaft des Pastors Borchert.
17. April 1751: Das Feuer zerstörte alle Gebäude bis zum Westtore. Das neu errichtete Pastorat blieb nicht vorm Feuer verschont. Es wurde jedoch nur das Dach zerstört.
10. April 1764: 17 Häuser gingen an dem Abend in Flammen auf.
29. April 1806: Es entstand eine Feuersbrunst, die sich mit solcher Schnelligkeit über die ganze Stadt ausbreitete, daß in wenigen Stunden 154 Wohnhäuser in Asche lagen. Auch der Turm der alten
Kirche, das Rathaus und das Pfarrhaus wurden ein Raub der Flammen. Nur der Südteil und ein Teil des Nordteils blieben vom Feuer verschont.
9. August 1885 brach in dem am Südgraben gelegenen Linnemannschen Hause ein Schadenfeuer aus und drei Tage später der größte Brand, dessen sich die noch heute lebende Generation Sendenhorsts zu
erinnern weiß. Ebenfalls brannte auch das Haus des Schmiedes B. Arnskötter. Der Wind begünstigte die Ausbreitung des Feuers und die gegenüberliegenden Häuser: Westmeier, Lewe brannten nieder.
23. Febr. 1886 trat die 1885 gegründete Freiw. Feuerwehr zum ersten Male in Tätigkeit. Es brannte das Haus des Steinhauers Anton Erdmann in der Schulstraße.
15. April 1887 brannte das Backhaus des Gutbesitzers Adolf Herte, Kspl. Sendenhorst.
1. März 1894: Speicher des Gutsbesitzers Niestert.
25. Juli 1894 infolge Blitzschlages Wagenhaus und Stallung des Gutsbesitzers Möllmann.
12. Okt. 1895: Scheune des Brennereibesitzers H. Roetering.
16. Nov. 1895: Haus des Schuhmachers Heinr. Wessel, Südgraben
11. Aug. 1896: Brand im Hause des Metzgers Th. Holthaus.
23. Febr. 1898: Brand in der Wielerschen Brauerei am Osttor.
17. Juni 1898 stand das Haus des Maurers Melch. Lackmann am Südgraben in Flammen.
6. Juli 1900: Scheune des Gutsbesitzers Heinr. Sch. Horstrup
6. Juli 1900: Klingelmannsches Haus am Osttore, vormals Strickers.
18.9.1901: Bartmannsche Haus am Nordgraben
30.9.1901 das Besitztum des Schmiedes Bernh. Stapel an der Schulstraße
9. Mai 1902: Brand in der Wielerschen Brauerei
23. Aug. 1902: Brand in der Wielerschen Brauerei
22. Sept. 1902 das Wohnhaus des Maurers Bernhard Wegmann am Westgraben
16.7.1903 vernichtete ein Schadenfeuer die in der Bauerschaft Elmenhorst gelegene Scheune des Brauereibesitzers Wieler.
25. Februar 1904 das Haus des Arbeiters Rottkemper am Ostgraben.
19. April 1904 im Nebengebäude des St.-Josephs-Stiftes.
26. Mai 1904 ein Schadenfeuer des Backhauses der Becklarschen Besitzung Sendenhorst-Kirchspiel.
7. Juli 1904: Brand beim Metzger Heinrich Kalthoff am Kirchplatz.
1. Okt. 1904 das Wißlingsche Gehöft in Sendenhorst-Kirchspiel
1906 löschte die Wehr einen Brand vor der Scheune des Brennereibesitzers Roetering, bevor das Feuer die Scheune selbst ergriff.
20. Februar 1907: Brand in dem Wohnhaus des Mühlenbesitzers J. Wößmann vor dem Westtore.
3. Dez. 1908: Brand im Mietshause des Sattlers J. Offers in der Nordstraße.
27. Febr. 1909 stand die Windmühle des Kassenbrock vor dem Südtore in Flammen.
1910: Scheunenbrand des Brennereibesitzers B. Roetering
1. Okt. 1910: Werkstatt und Scheune des Kupferschmiedes Joh. Happe
18. Aug. 1911: Wohnhaus des Metzgermeisters Heinr. Rottmann, Neustraße
14. Mai 1912: Werkstatt des Zimmermeisters Bernh. Kötter, Oststraße
Febr. 1913: Besitzung des Gutsbesitzers Heinr. Bartmann, Kirchspiel Sendenhorst
Juni 1913: Wohnhaus des Landwirts Becklaß, Sandfort
24. Aug. 1914: Lagerhaus des Bahnhofwirtes Anton Spiegel am Bahnhof
25. Juli 1915: Lagerhaus und Scheune des Maurermeisters Jos. Schmies, Placken
13. Aug. 1915: Besitztum des Maurers Anton Wegmann, Südgraben
26. Febr. 1916: Scheune und Stallung des Gutbesitzers Joh. Arnemann, Kirchspiel-Sendenhorst
27. Juni 1918: Wohnhaus des Briefträgers Bernh. Wessel, Südgraben, am gleiche Tage die Werkstatt des Schreinermeisters Ant. Früchte
20. März 1919: Wohnhaus des Landwirtes Bartmann-Maikötter
1. Sept. 1919: Besitztum des Gutbesitzers Jos. Halene, Kirchspiel
April 1921: Scheune des Brennereibesitzers Wwe. Fritz Hesse
4. Aug. 1921: Stallung und Scheune des Gutsbesitzers Ant. Feldmann, Kspl.
März 1922: Wohnhaus des Brennmeisters Heinr. Wolke, Nordgraben
17. März 1922: Mietshaus des Brennereibesitzers H. Roetering
30. Dez. 1922: Lager des Kaufmanns J. B. Holtel
24. Aug. 1924: Scheune des Althändlers C. Overhage und in der gleichen Nacht die Scheune des Fuhrunternehmers Th. Beumer.
Frühjahr 1925: Scheune des Brennereibesitzers C. Jönsthövel
29. Juli 1925: Wohnhaus des Arbeiters Franz Timmes, Mauritz
7. Nov. 1925: Wohnhaus des Kötters Bernh. Becklas, Bauerschaft Sandfort
1926 – 1928 kein Brand
13. Juni 1929: Werkstatt des Kupferschmiedes Bernh. Meyer, Weststraße
17. Sept. 1929: Brand in der Zichorienbrennerei des J. Lücke-Gehrmann
21. Okt. 1929: Scheunenbrand der Geschwister Suermann am Kirchplatz
20. Juli 1930: Wohnhaus des Bauern Aug. Lange, Bauerschaft Jönsthövel
15. Okt. 1930: Wohnwagen der Firma Alfred Schwiermann, Dortmund, der auf dem Holzplatze des B. Decker, Osttor, abgestellt war.
7. Sept. 1931: Scheune des B. Wißling, Bauerschaft Sandfort
4. März 1932: Wohnhaus, Stallung, Remise und Anbau des Bauern Hub. Tergeist
18. Juni 1932: Wohnhaus des Arbeiters Hubert Wessel, Südgraben
9. April 1934: Feldscheune des Heinrich Roetering und das Lager des Heinrich Telges, Oststraße
1935: Brand der Zichorienbrennerei Jos. Lücke-Gehrmann, Oststraße
1936 kein Brand
9. Sept. 1937: Wohnhaus des Landwirtes Bernh. Bruland, Bauerschaft Bracht
29. Juli 1938: durch Funkenflug beim Dreschen in Stroh- und Kaffhaufen beim Bauer Gustav Möllmann, Bauerschaft Bracht
20. Aug. 1939 schlug der Blitz in die Scheune des Bauern Wilh. Angelkotte, Bracht
2. Jan. 1940: Brand in der Rektoratschule
12. Mai 1940: Brand im Schafstall des Bauern Gerh. Niesters, Bauernsch. Brok.
14. Nov. 1940: Ein gewaltiger Sturm warf den Dachstuhl des Brennereibesitzers J. Silling, Oststraße, um.
1941 kein Brand
24. Mai 1942: Brand im Kükenstall des Gutes Roeper, Besitzer St.-Josephs-Stift
3. Aug. 1943: Stall des Viehkaufmanns Reinh. Siekmann, Weststraße
17. Febr. 1944: Hinterhaus des Geflügelzuchtberaters Bernh. Kötter, Prozessionsweg
16. Juli 1945: Giebelwand der Brennerei Karl Werring-Zurmühlen, Bauerschaft Elmenhorst
13. Dez. 1945: Stall des Heinr. Dorsel, Westtor
29. Aug. 1946: Kaffeerösterei des Heinr. Pohlmann, Ostgraben
1. Sept. 1946: Stallgebäude und Lager des Brennereibesitzers H. Everke, Neustraße
13. April 1947: Zimmerbrand bei Casper Linnemann, Südgraben
3. Juli 1947: Brand in der Brennerei der Wwe. Peter Horstmann (Bauerschaft Ringhöven).
19. Okt. 1948: Reparaturwerkstatt des Fahrradhändlers Th. Jaspert, Oststraße.
18. Febr. 1949: Wohnhaus und Stallung des Bauern Wilhelm Teiner-Heimann, Bauerschaft Bracht.
17. April 1949: Schornsteinbrand beim Bauer Gerh. Niestert.
2. Sept. 1949: Feldscheune des Ackerbürgers Bernh. Kamman, gleichzeitig brannte auch der Dreschkasten des Dreschmaschinenbesitzers Ant. Reul, Weststraße
Der Landkreis Beckum im Spiegel der Vor- und Frühgeschichte
Manchmal kann es nicht schaden, die eigene Tellerzone zu verlassen und über selbigen Rand hinweg zu schauen.
Sendenhorst Das älteste und einzig erhaltene
Denkmal aus jener dunklen Vorzeit des Kreises Beckum, über die uns keine schriftliche Urkunde berichtet, ist die große, aus Findlingen erbaute, langgestreckte Grabkammer auf dem Hiärwestkamp, südlich
Beckum, in der Bauerschaft Dalmer.
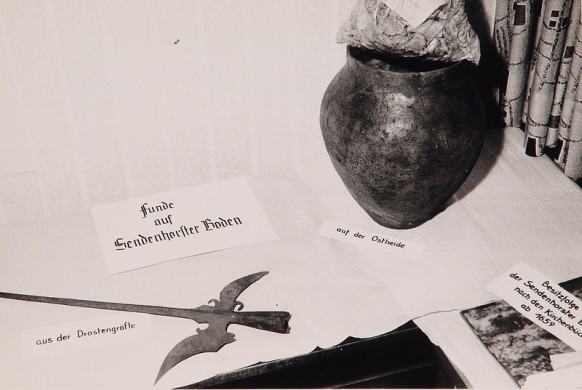
Bild:
Funde auf Sendenhorster Boden
Über 120 Jahre sind vergangen, seitdem dieses Grabmal zusammen mit den ähnlichen, aber inzwischen zerstörten, bei den Höfen Westerschulte und Wintergalen die Aufmerksamkeit und das Interesse der
Altertumsforschung fanden.
Der münstersche Historiker Dr. Erhard schrieb in einer in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erschienenen Schrift: „Nachricht von den bei Beckum entdeckten alten Gräbern“: „Sie können
nicht aus vorchristlicher Zeit herstammen, sondern müssen erst nach 803 entstanden sein, wo Karl d. Gr. das Verbrennen der Leichen bei Todesstrafe verboten hatte; so daß sie also die älteste Form
christlicher Begräbnisse in hiesiger Gegend darstellen.“ Ihm antwortete der um die westfälische Altertumsforschung hochverdiente Pfarrer Niesert in einer kleinen Abhandlung im Jahre 1836 unter dem
Titel: „Versuch eines archäologischen Beweises, daß die bei Beckum entdeckten alten Gräber die älteste Form christlicher Begräbnisse nicht darstellen.“ Er stellte die Erhard’sche Ausdeutung richtig
und wies die Gräber den „Hünenbetten“ zu, d. h. jenen in weiteren Räumen Nordwesteuropas aus Findlingen erbauten Grabkammern der Steinzeit.
Schließlich veröffentlichte im Jahre 1875 der bekannte Baurat F. A. Borggreve in der „Westfälischen Zeitschrift“, Bd. 33., einen Aufsatz über „Die drei Gräber bei Westerschulte und Wintergalen in der
Gegend von Beckum“, in dem er nähere Einzelheiten, auch über inzwischen durchgeführte Ausgrabungen mitteilte.Von diesen drei Gräbern ist heute nur noch die auf dem Hiärwestkamp beim Landwirt Kulke
erhalten und gerade vor einem Jahr auf Anregung und mit Unterstützung der Kreisverwaltung Beckum soweit freigelegt worden, daß ihre Umrisse und einstige Gestalt wieder sichtbar sind. Die beiden etwa
in O-W-Richtung sichtbaren Steinreihen von etwa 27 m Länge bildeten einmal die Wandsteine einer großen, in den Boden eingegrabenen Grabkammer, auf denen einst große Steine lagen, die diese Grabkammer
oben abdeckten.
Als Borggreve vor 80 Jahren seinen Bericht schrieb, war diese steinerne Grabkammer noch 29 m lang, 1,5 m bereit und 1,5 m hoch erhalten. Sie wurde im Jahre 1875 weitgehend zerstört, als man
versuchte, die Steine zu sprengen, um Material zum Straßenbau zu gewinnen. Sie waren aber schon 1860 vom Staat angekauft, so daß ihre völlige Vernichtung noch einmal aufgehalten werden konnte. Diese
lange Grabkammer ist in der Mitte etwas gebogen; hier zeigen heute noch 4 Steine, ursprünglich waren es 5, den Rest des Eingangs an, der in die eigentliche Kammer führte.
Das zweite Grabmal ähnlicher Art lag etwa 700 m entfernt auf dem gegenüberliegenden Hang am Kieslingskamp, beim Hofe Westerschulte, und ein drittes beim Hofe Rentrup-Wintergalen in der Gemeinde
Lippborg. Beide Anlagen wurden im vergangenen Jahrhundert zerstört, um Straßensteine und Prellsteine in Beckum und Hamm zu gewinnen. Sie waren ähnlich gebaut wie die in der Bauerschaft Dalmer und
etwa gleich groß, die eine 26 m, die andere 28 m lang. In beiden Kammern konnten aber von Borggreve und anderen noch vor der Zerstörung Grabungen durchgeführt werden, die uns wenigstens in etwa ein
Bild ihrer Einrichtung vermitteln. Sie enthielten sehr viele menschliche Knochen, die Reste der einmal hier Bestatteten. Der Boden der Kammer war mit einer Steinlage gepflastert, auf der die Toten
niedergelegt worden waren. Als Beigaben wurden kleine Steinbeile, Messer und Speerspitzen aus Feuerstein, durchlochte Tierzähne, ursprünglich als Kette getragen, Bernsteinstücke, ein
Kupferblechstreifen, verzierte Scherben und ein vollständiges Tongefäß gefunden.
Dies Gefäß ist in einer Art, nämlich mit eingestochenen Linien verziert, die vor allem aus den gleichzeitigen sogen. Megalithgräbern des nördlichen Westfalen und Nordwesteuropas bekannt sind. Die
Menge der Bestattungsreste, oft in mehreren Lagen übereinander liegend, kennzeichnet diese Kammern als Sippengräber, in denen die Bewohner der Umgegend ihre Toten bestatteten. Es handelt sich schon
um eine seßhafte Bevölkerung, die in festen Häusern wohnte und Ackerbau und Viehzucht betrieb. Die Beckumer Steinkisten, wie sie gern genannt werden, gehören zu einer Gruppe, hauptsächlich im
südwestfälischen und hessischen Raum verbreiteter Anlagen. Sie wurden um 2000 v. Chr. angelegt und sind eine landschaftliche Ausprägung der im gesamten west- und nordwesteuropäischen Raum
verbreiteten Großsteingräber.
Seit der Entdeckung dieser Gräber sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten weitere Fundplätze und Funde aus den Jahrtausenden vor Christi Geburt bis zur Zeit Karl d. Gr. um 800 n. Chr. beobachtet
worden, dank der Tatsache, daß sich in jeder Generation einige Männer fanden, die diesen unscheinbaren Zeugnissen der Geschichte des Beckumer Landes, den Steingeräten, Waffen, Gefäßresten und Gräbern
alter Zeit Interesse und Liebe bekundeten, so daß sich heute die Geschichte des Menschen in diesem Raum immer klarer übersehen läßt.Gewiß ist es nicht gerade übermäßig viel, was inzwischen gesammelt
und beobachtet worden ist. Das hat in diesem Land seine besonderen Gründe: denn weite Teile des Kreises bestehen an der Oberfläche aus schweren lehmigen und tonigen Böden, die nicht nur in alter Zeit
ungünstig für eine dauerhafte Besiedlung waren, sondern die auch die möglichen unscheinbaren Bodenfunde derart fest umklammern, daß sie vielfach unerkannt bleiben. Nur in einigen eingestreuten,
– vor allem im Nordwesten, Nordosten und Süden des Kreisgebietes – langgestreckten sandigen Inseln liegen bessere und günstigere Bodenarten vor, die von dem Menschen schon früh besiedelt wurden, aber
auch heute noch die Reste ihrer Siedlungen und Gräber leichter erkennen lassen.
Siedlungen aus dieser ältesten Zeit sind bisher nicht gefunden worden. Doch liegen aus dem ganzen Kreisgebiet neben einigen durchbohrten Geweihhacken, die bei Baggerarbeiten an der Lippe in den
Gemeinden Liesborn und Lippborg gefunden wurden, 24 Steinbeile und -Äxte vor, die erkennen lassen, daß der Raum besiedelt war. Es handelt sich – wie zu erwarten – um Stücke aus Feldgestein, aber auch
Feuerstein, deren verschiedene Formen anzeigen, wie hier schon in früher Zeit Einflüsse aus westlich, nördlich, südlich und östlich benachbarten Kulturen zusammenkamen.Aus der folgenden Bronzezeit
gibt es aus deren älteren Abschnitten bisher nur aus einem Urnenfriedhof von Liesborn den Rest einer bronzenen Schmucknadel, deren oberes Ende zu einer flachen Spiralscheibe zusammengerollt
ist.
Für die ausgehende Bronzezeit und die nachfolgende Eisenzeit liegen nun eine ganze Reihe größerer Grabfelder und auch einiger Siedlungen vor. Aus den Urnenfriedhöfen in Neuahlen, Heessen, Liesborn,
Lippborg (in der Polmerheide und bei Lütke Uentrup), Oelde und Sendenhorst gibt es, trotz der vielen unbeobachteten Zerstörungen, eine ganze Reihe von charakteristischen Grabgefäßen, in denen die
verbrannten Überreste der Toten beigesetzt waren: sorgfältig gearbeitete doppelkonische und schalenförmige Urnen, z. T. mit reichen Verzierungen geschmückt, weitmündige Schüsseln mit schräggestellten
Rändern und sogenannte Rauhtöpfe (s. Heimatkal. Kreis Beckum 1954). Sie zeigen, wie schon für die Steinbeile der ausgehenden Steinzeit festgestellt, auch hier vielfache Verbindungen und Einwirkungen
aus nördlich und westlich benachbarten Kulturen, die entlang der alten natürlichen Völker- und Handelsstraße der Lippe sich hier auswirken konnten. Im Jahre 1955 haben Grabungen des Landesmuseums in
Oelde neben einer ganzen Reihe von Urnen auch erstmalig Spuren jener schon auf vielen Grabfeldern Westfalens, der Rheinlande und der Niederlande festgestellten merkwürdigen Anlagen beobachten lassen;
es handelt sich um langgestreckte, von ehedem flachen Gräbchen umhegte Anlagen, die innerhalb der Friedhöfe besonders geweihte Plätze zur Durchführung von Totenfeiern oderähnlichem zeigen. Reste von
Opferfeuern, erschlagenen Gefäßen, wiederholt beobachtet, lassen solche Bestimmung vermuten.
Besondere Beigaben, bronzene Rasiermesser, Spangen, Pinzetten, Beile und Speerspitzen sind in den Urnen bisher nicht gefunden worden. Nur ein Einzelfund, der im Jahre 1937 in der Gemeinde Wadersloh
zutage kam, ein großer bronzener Halsring, vermag auch hier zu bestätigen, daß solche großen Schmuckstücke, die aus den benachbarten west-, mittel- und süddeutschen Landschaften reichlich bekannt
sind, auch hier geschätzt und getragen wurden. Neben diesen Friedhöfen sind nun aus der Gemeinde Sünninghausen seit Jahren Siedlungsstellen der letzten Jahrhunderte vor Christi Geburt bekannt
geworden. Die letzten im Jahre 1952 durchgeführten Grabungen erbrachten aus einer Reihe alter, glockenförmiger, bis zu 2 m tiefen Vorratsgruben sehr viele Bruchstücke von ebenfalls schalenförmigen
und schlüsselförmigen, aber auch hohen topfförmigen, gerauhten Gefäßen. Sie gehören dem 3. und 2. Jahrhundert vor Chr. Geb. an.
Die Frage nach dem Namen der Menschen und ihrem Volkstum, Germanen oder Nichtgermanen, können wir auf Grund der keramischen Funde dahin beantworten, daß es sich hier wohl um germanische Stämme
gehandelt hat, müssen aber dabei bedenken, daß in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt aus dem nordwesteuropäischen Raum, bedingt durch klimatische Veränderungen, ganze Gruppen in die
linksrheinischen Gebiete abgewandert sind, mit dem Ziel, hier neues Siedlungsland zu suchen. Diese Ereignisse werden uns in den Berichten der römischen Schriftsteller noch angezeigt. Da aber an der
ganzen Südflanke des Kreises Beckum jene alte Völkerstraße führt, dem Verlauf der Lippe entlang, müssen wird durchaus damit rechnen, daß hier nicht nur ganze Gruppen seßhaft waren, sondern auch ein
stetes Hinzuziehen und Abwandern stattgefunden hat. Erst für die Zeit um Christi Geburt und den Beginn der Römerkriege werden uns Namen überliefert. Es sind die Brukterer, die hier eingewandert sind
und als Bewohner des östlichen Münsterlandes für die Zeit der Römerkriege wiederholt bezeugt sind. Spuren ihrer Siedlung oder Grabfelder sind bisher noch kaum gefunden. Hier läßt sich einmal deutlich
erkennen, wie viel noch zu tun ist, um zu den schwachen schriftlichen Nachrichten all die Siedlungsplätze und Grabfelder wiederzufinden, in denen sie wohnten oder ihre Toten bestatteten. Wenn die
Römer in den Kriegszügen von Drusus bis Germanicus, d. h. von 11 vor bis 14 nach Chr. in einzelnen Jahren mit 2 bis 4 Legionen im rechtsrheinischen Raum operierten, das sind 10- bis 20.000 Mann, muß
dieses Land verhältnismäßig dicht bevölkert gewesen sein, um diesen Aufwand der römischen Angriffskriege überhaupt zu verstehen. Zeugnisse dieser Kriegszüge sind bisher im Kreisgebiet nicht zutage
getreten. Doch ist es auf Grund der schriftlichen Quellen sicher, daß sie diesen Raum wiederholt durchzogen und die Siedlungen der einheimischen Bevölkerung verwüstet haben. Bis jetzt gibt es an
römischen Funden nur eine kupferne Münze des Kaisers Augustus. Sie wurde im Jahre 1955 von Schulkindern auf der nördlichen Lippeterrasse in Heessen gefunden. Nicht weit entfernt sollen vor 120 Jahren
schon römische Gefäße gefunden worden sein. Eine zweite römische Münze, von Marc Aurel, wurde zu Beginn dieses Jahrhunderts beim Brückenbau über den Quabbenbach in Lippborg aufgelesen.
Germanische Siedlungsreste dieser Zeit werden seit Jahren in der Sandgrube in der Bauerschaft Hoest, Gem. Ennigerloh, beobachtet und wurden auch vor wenigen Jahren bei einer kleineren Untersuchung
durch das Landesmuseum in Münster wieder angetroffen. Die ausgegrabenen Siedlungsgruben und Herdstellen mit den Fundstücken, den Resten zerbrochener Gefäße, Holzkohlen- und Eisenschlacken, lassen
sicher einen einheimischen Siedlungsplatz aus der Zeit Christi Geburt vermuten (s. Heimatkal. Kreis Beckum 1953). Ähnliche Fundstücke, die ebenfalls auf Siedlungsplätze dieser Zeit verweisen, sind
von Neuahlen und Oelde bekannt geworden. Der letztere lieferte außerdem ein Bruchstück einer sogenannten Armbrustfibel, die dem ausgehenden 2. Jh. angehört. Aus den historischen Quellen wissen wir,
daß kurz vor 100 n. Chr. die Chamaver im nordwestlichen Münsterland zusammen mit den Angrivariern die Brukterer in einer großen Schlacht besiegten und die Angrivarier sich nun im östlichen
Münsterland und östlichen Westfalen ansiedelten. Große Teile der Brukterer sind damals in den Raum südlich der Lippe übergesiedelt, wo wir sie nicht nur im 4. Jh., sondern noch zur Zeit der
Sachsenkriege und in den frühen Quellen des Mittelalters antreffen. Für das 3. bis 5. Jh. liegen mit Ausnahme einer Siedlungsstelle bei Lütke Uentrup keinerlei Funde vor. Doch besitzen wir aus den
römischen schriftlichen Quellen genügend Angaben, um wenigstens das große historische Geschehen kurz skizzieren zu können.
In diesen Jahren begann im gesamten mitteleuropäischen Raum jene große Völkerwanderung, die von rund 200 n. Chr. ab in immer wiederholten Vorstößen sich vor allem gegen die Grenzen des römischen
Staates richtete, um in den südlicheren und westlicheren Teilen Europas neues Siedlungsland zu gewinnen. Einzelne Teile der Bevölkerung in Westfalen und den angrenzenden Niederlanden nahmen unter dem
Namen der Franken an diesen Zügen teil. Andererseits schlossen sie aber gegen hohe römische Tributzahlungen auch wiederholt Verträge mit den Römern ab, in denen sie sich zu Bundesgenossen der Römer
machten und die Grenzen des römischen Reiches gegen die aus dem innergermanischen Raum nachdrängenden Scharen verteidigten. Wir müssen auf Grund der schriftlichen Quellen annehmen, daß in dieser Zeit
auch im Inneren Westfalens mehrere kleine, von Königen regierte Völkerschaftsgaue bestanden, von denen die Chamaver und Brukterer die mächtigsten waren, während uns für die Angrivarier kaum
Nachrichten überliefert sind. So entstanden zwischen dem linksrheinisch-römischen Gebiet und dem mittleren und westlichen Westfalen sehr enge Verbindungen, die ihren Niederschlag in vielen Funden
römischer Herkunft gefunden haben. Aus diesen Wirren löste sich in der zweiten Hälfte des 4. Jh. jener Stamm der Salfranken aus dem rechtsrheinisch-niederländischen Gebiet, die im Laufe des 5. Jh.
zunächst als Bundesgenossen der Römer nach Süden zogen und am Ende des 5. Jh. nach dem Zusammenbruch der römischen Macht, einen eigenen Staat errichteten, der bald die führende Rolle im Abendland
übernahm.
Aufbauend auf dem Reichtum alter römischer Zivilisation im linksrheinischen Raum, unter Hinzunahme alter Kunstfertigkeiten, die die Goten aus dem Schwarzmeergebiet auf ihren Zügen nach Gallien
mitgebracht hatten, entstand hier im Laufe des 5. und 6. Jh. die reiche, sogen. fränkische Kultur, die bald weite Teile Westeuropas überstrahlte. Ihre bedeutenden Zeugnisse sind auch aus den Gräbern
des fränkischen Friedhofs bei Beckum bekanntgeworden. Sie wurden in den Jahren 1860 – 63 ausgegraben und im Jahre 1865 durch Baurat F. A. Borggreve vorbildlich veröffentlicht. Insgesamt wurden 86
Gräber freigelegt, eine ganze Reihe weiterer war schon bei Steinbrucharbeiten zerstört worden. Die Toten waren unverbrannt, im allgemeinen in Nord-Südrichtung beigesetzt, der alten heidnischen
Grabrichtung. Ihnen waren als Beigabe Gefäße aus Ton und Glas, den Frauen zahlreiche Schmuckstücke, Perlen und Gewandspangen, den Männern meist Waffen, Schwerter Schilder und Pfeile mitgegeben.
Außerdem wurden 17 Pferdebestattungen angetroffen. Die erhaltenen Funde reichen etwa von 500 - 700 n. Chr., d. h. in dieser Zeit hat in nicht allzu weiter Entfernung von den Gräbern eine größere
Siedlung gelegen. Ob schon in Beckum selbst oder in „Altenbeckum“ (Flurbezeichnung), ist noch unklar.
Die Frage, ob der Abbruch dieses Grabfeldes um 700 mit den historisch bezeugten Vorstößen der Sachsen zusammenhängt, die in jenen Jahren die Brukterer südlich der Lippe unterwarfen und den
westfälischen Raum eroberten, kann noch nicht beantwortet werden. Vermutlich wird sich auf Grund gewisser älterer Fundnachrichten eines Tages feststellen lassen, daß an anderer Stelle im Gebiet der
Stadt Beckum auch der Friedhof der sächsischen Zeit gelegen hat und damit auch hier Anschluß an die ersten historischen Quellen aus der Zeit Karls d. Gr. gewonnen werden. Bisher liegt nur ein
einzelnes Tongefäß aus dieser Zeit von Sendenhorst vor. Im Jahre 772 begannen, nach vielen vereinzelten früheren Vorstößen der fränkischen Könige, die Angriffskriege Karls d. Gr. gegen das
westfälische Sachsenland, um dieses Land zu unterwerfen und die Bevölkerung dem Christentum zuzuführen. Das Ende war die sächsische Niederlage mit der Unterwerfung Widukinds. Es begann, im Anschluß
an die auf dem Reichstag zu Paderborn erlassenen Kapitularien, die Neuordnung des Landes, die Einrichtung der Missionsbezirke und die Gründung von Pfarreien und Kirchen. Die überaus große Anzahl der
schon in der Zeit von 780 bis 830 gegründeten Urpfarreien, zunächst Beckum und Ahlen, wenig später Herzfeld, Liesborn und Oelde, lassen für diese Zeit eine ziemlich dichte Bevölkerung erschließen.
Ein großer Teil der alten Bauernhöfe im Kreise Beckum dürfte sicher in diese Zeit zurückzuführen sein. Die ersten vorläufigen Arbeitsergebnisse hierüber, die wir Anton Schulte, Beckum, verdanken,
sind so vielversprechend, daß wir ihrer endgültigen Veröffentlichung hier nicht vorgreifen, sondern in 1 bis 2 Jahren an dieser Stelle besonders darüber berichten wollen.
Daß dieser Übergang, vom Ende der Sachsenkriege bis zur neuen karolingisch-christlichen Zeit mit der Errichtung der ältesten Kirchen, sich nicht in wenigen Jahren vollzog, sondern wohl 1 bis 2
Generationen dauerte, vermögen auch hier, wie an vielen anderen Stellen Westfalens, einige Grabfelder anzudeuten, von denen eines in Sünninghausen sicher dieser Übergangszeit angehört; denn in einem
der Gräber fand sich noch ein großes eisernes Schwert aus der Zeit um 800 n. Chr. Andere in Ennigerloh und auf dem Mackenberg mit ebenfalls ost-westlich angelegten beigabenlosen Gräbern müssen
wahrscheinlich ebenfalls dieser Zeit zugeordnet werden (s. Heimatkal. Kreis Beckum 1952).
Mit der Anlage der Kirchen beginnt nun auch für den Kreis Beckum das schriftliche Urkundenmaterial reicher zu fließen, so daß hier die älteren unscheinbaren Bodenurkunden nicht mehr allein die
Geschichte des Beckumer Landes zu schreiben brauchen.
Zum Schluß ist eine besondere Gruppe von Bodendenkmälern noch zu erwähnen, die auch im Kreise Beckum in einigen schönen Zeugnissen vorhanden sind: die kleinen und großen Wallburgen, die hier z. T.
nahe bei alten Höfen, z. T. aber auch tief in den Wäldern versteckt seit Jahrhunderten ruhen. In der Gemeinde Dolberg liegt am Südhang der Beckumer Berge eine kleine Befestigung, die „Hünenknäppe“
genannt. Sie stammt, wie Grabungen im vergangenen Jahrhundert erwiesen haben, aus der Zeit Karls d. Gr. Ihre historische Bedeutung, ob sie von Karl selbst angelegt ist oder nur einen befestigten
Herrensitz dieser Zeit darstellt, wie er auch von anderen Stellen bekannt ist, bleibt noch zu klären. Die größte, in ihrer gesamten Lage schönste und durch die Mächtigkeit ihrer alten Wälle
eindrucksvollste Burg ist das sogenannte „Germanenlage“ in den Buchenwäldern im Havixbrock. Ihre Bedeutung und zeitliche Stellung ist noch völlig ungeklärt; wahrscheinlich gehört sie schon dem 10.
Und 11. Jh. an. Auch die Wallanlage „Altes Lager“ in der Gemeinde Liesborn, auf dem Ostufer der Glenne, ist in ihrer historischen Bedeutung und zeitlichen Stellung bisher noch nicht erforscht. Aus
dem 12. bis 14. Jh. dürfte die sogenannte „Burg im Bröggel“ in der Gemeinde Lippborg stammen, ein typischer mittelalterlicher Turmhügel mit zwei umlaufenden Wällen. Eine ähnliche Anlage, die aber
fast vollständig zerstört ist, lag ebenfalls in der Gemeinde Lippborg beim Landwirt Günnewig. Wir müssen in diesen kleinen Turmhügeln wohl die Sitze kleinerer Herrengeschlechter des hohen
Mittelalters sehen.
Mit der hier gegebenen kurzen Darstellung der vor- und frühgeschichtlichen Funde und Denkmäler im Kreise Beckum ist nicht nur zu erkennen, welchen Wert diese Bodenfunde als historische Quellen besitzen und welches allgemeine Bild der Geschichte dieses Raumes sich mit ihnen zusammenfügen läßt, sondern eindringlicher noch erwächst daraus die Einsicht, wie viel noch zu tun ist, um wirklich ein volles Bild jener vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende zu gewinnen. Hier kann jeder helfen, dem die Heimat und ihre Geschichte noch lieb und wert sind. In den Sandgruben und den Feldern, bei jeder Erdausschachtung können die kleinsten Beobachtungen wertvollste Hinweise geben und unscheinbare Funde den Schlüssel zu größten Entdeckungen bieten. Vor allem aber den Bauern und Landwirten, denen die Geschichte ihrer Höfe etwas gilt, erwächst hier eine neue Möglichkeit, Jahrtausende alte Quellen aufzuschließen und zu gewinnen. ünster aufbewahrt.
Die Hardt bei Sendenhorst Heimatkalender 1959 | A. Stafflage
... Die Entstehung und Bildung des
Kiessandrückens, der sich von Ennigerloh über Sendenhorst, Albersloh, Hiltrup, Münster, Sprakel bis über Neuenkirchen hinaus erstreckt, ist noch nicht restlos geklärt.
Fest steht, daß es sich bei der zwar langen, aber schmalen Schuttbedeckung um eiszeitliche Ablagerungen handelt,
die noch heute der Landschaft ein eigenes Gepräge geben. Durch die Gletscher mit ihren Schmelzwassern und ihren Schuttmassen erhielten auch die Sendenborster Hardt ihre wellige Geländeform und der
Boden seine letzte Gestaltung. Darum unterscheidet sich diese Bauerschaft wesentlich von den benachbarten Ackerbau- und Wiesenlandschaften.
Noch vor einem Menschenalter standen auf dem sandigen und trockenen Boden weite Kiefern- und Fichtenwälder. Jung und alt pilgerte durch eine herrliche Birkenallee zur "Waldmutter", um hier, inmitten
der Wälder, den Alltag zu vergessen.
 Bild:
Bild:
Ausgebaggerte Sandkuhle auf der Hardt
Heute gleicht die Hardt einem Seen und Dünengebiet überall leuchten die Zeugen der Eiszeit, die tiefen und hellen Sandbänke, auf. Die von schmalen schwarzen Streifen unterbrochenen Sandschichten
schimmern in den verschiedensten Farben, von dunkelbraun über hellgelb bis weiß. Ihre stark wechselnde Abbauwürdigkeit reicht von nur vier Meter bis über zwölf Meter Tiefe. Mitunter überdeckt
Geschiebelehm die an den Rändern der schmalen Kiesrandzone befindlichen Sandbänke. Bunt gemischt und wirr durcheinander liegen große und kleine skandinavische Blöcke, die das Gletschereis auf seinem
Rücken mitführte, in dem Sand. Manche von den Gesteinen sind glatt und rund gehobelt worden, manche von ihnen tragen deutliche Schleif- und Auswaschungsspuren.
Ein vor kurzem aufgedeckter riesiger Irrblock, der vorzugsweise aus Gneis besteht, zieht täglich die Aufmerksamkeit der Besucher der Gaststätte" Waldmutter" auf sich. Der von der Bernsteinkiefer als
Harz ausgeschiedene Bernstein, den man hin und wieder in dem Sand findet, wurde gleichfalls mit den Eismassen nach hier verfrachtet. Wie auf der Hardt gemachte Funde beweisen, belebten große
Wildarten, darunter das Mammut und das wollhaarige Nashorn, das eisfreie Land. Für die frühe Besiedlung der Hardt war die trockene und höhere Lage ausschlaggebend. Zudem ließ sich der Sandboden mit
den primitiven Geräten leichter bearbeiten.
Nach dem Werdener Einkünfteverzeichnis hatte um 1150 der Hof Folcmar auf der Hardt 20 Scheffel Hafer, 10 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Roggen und der Hof Buchard daselbst 2 Scheffel Roggen und 2 Widder
abzuliefern.
Täglich greift heute der Mensch in die Naturlandschaft der Hardt ein und zwingt ihr seinen Formwillen auf.
 Wegen der kiesigen und grobsandigen Zusammensetzung des Bodens sind Tag für Tag fleißige Hände an der
Arbeit, um die Sande an die Baustellen zu schaffen. Schwere Bagger sorgen dafür, daß auch die tiefsten Sandschichten ausgebeutet werden. Infolgedessen gähnen an vielen Baustellen tiefe Löcher. Auch
zur Herstellung von Kalksandsteinen eignen sich die Hardtsande vorzüglich. Täglich werden Zehntausende von ihnen hergestellt und verfrachtet. Aus dem sauberen Grundwasser der Hardt fördert ein
Pumpwerk der Stadt Ahlen einen Teil des Wasserbedarfs für Ahlen. Seit einigen Jahren bezieht auch Sendenhorst das Wasser von der Ahlener Pumpstation. Heute sind große Sandstriche bereits abgebaut.
Gerade sie sind in ihrem Pflanzen- und Tierbestand von besonderem Reiz. Da sind breite ehemalige Sandteiche, in denen Laub- und Nadelwaldpartien miteinander abwechseln. Andere sind fast ganz dem
Ackerbau erschlossen. Hier wechseln Kartoffel- Roggen- und Maisfelder miteinander ab. An manchen Stellen hat eine Ortsteinschicht die Sande verschüttet und die Sumpf- und Bruchbildung begünstigt. In
den schwammartigen und nährstoffreichen Gewässern siedelten sich Binsen, Schilfrohr, Froschlöffel, Pfeilkraut, Schachtelhalm und Hahnenfuß an. Zahlreiche Frösche und Kröten finden in dem
Pflanzengürtel günstige Lebensbedingungen. Di ese wiederum locken den grauen Fischreiher und die kleine und große Wildente herbei. Aus dem Ufergebüsch ertönen die halbpfeifenden "Kirket"-Rufe des
Wasserhühnchens. Waldkauz und Arbeiter, die er in der Morgenfrühe mit dumpfen "Huhuhu"-Rufen begrüßt, sind gute Freunde geworden.
Wegen der kiesigen und grobsandigen Zusammensetzung des Bodens sind Tag für Tag fleißige Hände an der
Arbeit, um die Sande an die Baustellen zu schaffen. Schwere Bagger sorgen dafür, daß auch die tiefsten Sandschichten ausgebeutet werden. Infolgedessen gähnen an vielen Baustellen tiefe Löcher. Auch
zur Herstellung von Kalksandsteinen eignen sich die Hardtsande vorzüglich. Täglich werden Zehntausende von ihnen hergestellt und verfrachtet. Aus dem sauberen Grundwasser der Hardt fördert ein
Pumpwerk der Stadt Ahlen einen Teil des Wasserbedarfs für Ahlen. Seit einigen Jahren bezieht auch Sendenhorst das Wasser von der Ahlener Pumpstation. Heute sind große Sandstriche bereits abgebaut.
Gerade sie sind in ihrem Pflanzen- und Tierbestand von besonderem Reiz. Da sind breite ehemalige Sandteiche, in denen Laub- und Nadelwaldpartien miteinander abwechseln. Andere sind fast ganz dem
Ackerbau erschlossen. Hier wechseln Kartoffel- Roggen- und Maisfelder miteinander ab. An manchen Stellen hat eine Ortsteinschicht die Sande verschüttet und die Sumpf- und Bruchbildung begünstigt. In
den schwammartigen und nährstoffreichen Gewässern siedelten sich Binsen, Schilfrohr, Froschlöffel, Pfeilkraut, Schachtelhalm und Hahnenfuß an. Zahlreiche Frösche und Kröten finden in dem
Pflanzengürtel günstige Lebensbedingungen. Di ese wiederum locken den grauen Fischreiher und die kleine und große Wildente herbei. Aus dem Ufergebüsch ertönen die halbpfeifenden "Kirket"-Rufe des
Wasserhühnchens. Waldkauz und Arbeiter, die er in der Morgenfrühe mit dumpfen "Huhuhu"-Rufen begrüßt, sind gute Freunde geworden.
 Bild: Arbeiter beim Sandabbau
Bild: Arbeiter beim Sandabbau
An manchen Stellen geht die Bruchflora in eine Heideflora über. Seltsame Naturkinder bevölkern die trockenen Sandhügel. Hier wuchern der flammende Ginster, der dunkelgelbe Rainfarn, die stolze
Königskerze, der azurblaue Natterkopf, das rosafarbene Weidenröschen, der silberweiße Hasenklee und der blaue Teufelsabbiß. Seltene Moose und Flechten und von Amerika eingewanderte Gräser bedecken
den trockenen Boden. Katzenartig beschleicht die Eidechse auf den Sandhügeln Heuschrecken und Grashüpfer. In den weißen Sandwänden schufen die Uferschwalben ihre langen Röhren und bauten darin ihre
seltsamen Nester. Die gesellig lebenden Wildkaninchen wohnen in dem leichten Sandboden in umfangreichen Kolonien. Kaum noch lassen sich die Jungen durch das Warnzeichen der Alten, das Klopfen mit den
Hinterläufen auf den Boden, stören. Vor kurzem gewahrte beim Sandaufladen ein Arbeiter ein Nest mit vier halbwüchsigen Jungen auf seiner Schippe.
Besonders anziehend wirken die ausgebaggerten Sandteiche, die großen Seen gleichen. Erlen, Birken und Pappeln spiegeln sich in dem Uferwasser. In den Seen tummeln sich Hechte, Karpfen, Schleien und
Weißfische. Gefiederte Gäste aus dem Norden bei eben mitunter die stillen Teiche. Die tiefen Baggerlöcher bilden für Badende eine ernste Gefahr. In den letzten zwanzig Jahren forderte in ihnen der
nasse Tod mehrere Opfer. So gestaltet sich das Landschaftsbild der Hardt sehr abwechslungsreich. Mit dem Geologen, dem Zoologen und dem Botaniker bewundert hier der heimatgebundene Mensch die
Geheimnisse der Erdgeschichte und erfreut sich an den Wundern einer reichen Tier- und Pflanzenwelt.
SENDENHORSTER HEIMATWOCHE 10. 17. SEPTEMBER 1950
 Schaufenster-Wettbewerb - 2 Ausstellungen:
Schaufenster-Wettbewerb - 2 Ausstellungen:
Heimat in Schrift und Bild Sendenhorst einst und jetzt
Preis 10Pfg.
PROGRAMM DER HEIMATWOCHE
Sonntag, den 10. September 1950
11.00 Uhr: Festliche Eröffnung der Heimatwoche. Ansprache des 1. Vorsitzenden des Heimatvereins Herrn Amtsrentmeister Bernhard Fascies, Sendenhorst.
Eröffnung durch Herrn Stadtdirektor Esser (Die Ansprache wird durch Lautsprecher übertragen)
Großes Platzkonzert der Sendenhorster Stadtkapelle
Die Wachtparade, Marsch .............................H. L. Blankenburg
Iris-Ouvertüre .................................................P. Zien
Aus alter und neuer Zeit, Potpourri ..............Heinrich Halter
Kaiserin Viktoria, Walzer ...............................Jul. Gottlöber
Dornröschens Brautfahrt, Charakterstück. ...Max Rhode
Kreuzritter-Fanfaren-Marsch .........................R. Henrion
Lambertusfeiern der Nachbarschaften
Montag, den 11. September, Dienstag, den 12. September,
Donnerstag, den 14. Sept.
und Freitag, den 15. September
Wenn eine Scheibmaschine, dann von Franz Pöttken jun., Sendenhorst | Schulstraße 245 | Fernruf 214
Jubiläums-Reit- und Fahrturnier
Sonntag, 10. September 1950 auf dem Sportplatz
8.00 8.30 -
9.30 14.30 14.45 15.00 15.30 16.10 16,40 16.55 17.25 17.35 17.50 18.20
18.30 8.30 Uhr 9.30 Uhr 10.20 Uhr
13.30 Uhr 14.45 Uhr 15.00 Uhr 15.30 Uhr 16.10 Uhr 16.40 Uhr
16.55 Uhr 17.25 Uhr
17.35 Uhr 17.50 Uhr
18.20 Uhr 18.30 Uhr
19.00 Uhr Vorprüfungen:
3 Dressurprüfung Klasse A 2 Dressurprüfung Klasse A
1 Materialprüfung für Reitpferde
Hauptprüfung:
Antreten der Reiter am Kriegerdenkmal Festzug durch die Stadt zum Turnierplatz (Sportplatz)
la Materialprüfung für Reitpferde (Abteilung leichte Pferde) 3 Dressurprüfung Klasse A
5 Jagdspringen Klasse A
Schaunummer: Reiterquadrille des Reitervereins Sendenhorst
7 Eignungsprüfung für Wagenpferde (Einspänner)
2 Dressurprüfung Klasse A
4 Jagdspringen Klasse A Schaunummer
1b Materialprüfung für Reitpferde (Abteilung schwere Pferde) 8 Eignungsprüfung für Wagenpferde (Zweispänner) Schaunummer
6 Glücksjagdspringen Kiasse A
Für gute Lautsprecherübertragung und Sitzgelegenheit ist bestens gesorgt. Sämtliche Preise sind im Schaufenster der
Firma Hubert Siekmann ausgestellt
Die Ehrenpreise wurden freundlicherweise von der Sendenhorster Geschäftswelt gestiftet und wir sagen hiermit unsern herzlichsten Dank. Wir bitten die Bevölkerung, bei ihren Einkäufen die hiesigen
Geschäfte zu berücksichtigen.
Reit-, Zucht- und Fahrverein Sendenhorst

2 Ausstellungen Heimat in Schrift und Bild (Borromäus-Bücherei, Kirchplatz) Sendenhorst im Bild einst u. jetzt (Fr. Pöttken jun., Schulstraße) Die Ausstellungen sind während der ganzen Woche von 8-18
Uhr durchgehend geöffnet.
Bei der Ausstellung: -Sendenhorst im Bild sind die Firmen Wilhelm Westmeier. Tischlerei, und Gartenbaubetrieb H. Brüggemann beteiligt.
183 Jahre 171 157 155 104 102 100 92 75 74 70
Sendenhorst die Stadt der Kornbrenner
12 Brennereien
99 "3
"9 ""
H. Brüning, Inh. Roetering, Weststr.
Graute-Hesse, Weststr.
Peter Horstmann, Ringhöven
Ferd. Silling, Inh. Jos. Silling, Oststr. Johannes Silling, Weststr.
B. Arens-Sommersell, Weststr. Zurbonsen-Bonse, Südstr.
Anno 1767 1779 1793 1795 1846 1848 1850
1858 1875 1876 1880 J. H. Everke, Kirchplatz
J. H. Boecker, Inh. H. Laink-Vissing. Oststr.,,
Carl Werring, Elmenhorst
Th. Jönsthövel, Nordstraße
93 W - Werktags
19 "1
Nach Neubeckum: 5.31 W 7.39 täglich 9.53 TW 13.17 TW 14.11 täglich 16.22 TW 19.56 täglich 0.04 T täglich
S Sonntag und an Feiertagen
13 "" "9 Während der Heimatwoche ist der Bevölkerung Gelegenheit gegeben, die Sendenhorster Kornbranntwein-Brennereien in Betrieb zu besichtigen
93
Losto-Film-Theater, Sendenhorst
Unser Programm vom 8. 12. September 1950
Das Lied von Bernadette
Das große Filmwerk von dem die Welt spricht, jetzt auch in Sendenhorst. Zur Heimatwoche der passende Film, der jeden Sendenhorster angeht. Das Lied der Bernadette" nach Franz Werfels weltbekannten
Roman Unser Programm vom 15.-18. September 1950
Der große Farbfilm: ,,Die Wildnis ruft"
Dieser behandelt das mühevolle Arbeiten in der Wildnis. Von ständiger Gefahr umgeben, leben dort die Menschen ein arbeitsames Leben. Ein Film wie ein Volkslied. Ein Film, der allen in Erinnerung
bleiben wird. Jung u. alt spricht dieser Film an, der zu den besten Farbfilmen der Welt zählt.
Abfahrzeiten der Personenzüge von Bahnhof Sendenhorst: Nach Münster: 6.03 W 6.49 W 7.39 TW 8.43 T täglich 11.33 TW 12.36 täglich 14.11 TW 15.34 täglich 18.06 W 20.57 täglich 22.17 TS
11.32 T täglich 18.05 W 18.52 W
T- Triebwagen
Zusammenstellung und Druck: Franz Pöttken jun., Sendenhorst
19.30 Uhr
Großes Volksliedersingen
Musik:
Gem. Chor:
an der Ostseite der St. Martini-Pfarrkirche am Mittwoch, dem 13. September 1950
Kinderchor:
Kirchenchor Caecilia 1869" Sendenhorst (gem. Chor) Leitung: Chormeister Eberhard Haselmann
Kinderchor der Katholischen Volksschule Sendenhorst Leitung: Lehrer Willi Brinkmann
Die Sendenhorster Stadtkapelle
Leitung: Kapellmeister Anton Jaspert
Programm
Alte Kameraden, Marsch
Herr Smitt
Kinderchor: Duorpkind
Volkslied:
Volkslied: Musik:
Gem. Chor:
Musik: Gem. Chor: O Hannes, wat en Hoot!
Mitwirkende:
C. Teike
Hans Friedrich Micheelsen Text: Christine Koch, Satz: Werner Göhre O wie schön is mien Westfaolen, Text: A. Kraus, Mel.: v. J. Inkermann An der Tafelrunde, Potpourri Julius Gottlöber
Hans Friedrich Micheelsen
Uraufführung des neuen plattdeutschen Heimatliedes Mönsterland, mien Heimatland
Text: Franz Pöttken jun., Satz und Weise: Hans Harzheim
Im schönsten Wiesengrunde
Aennchen von Tharau, Charakterstück
v. W. Ganzhorn Julius Gottlöber Ernst Harloff
Maiken wuß du frien
Kinderchor :
Moder Nacht
Text: Fr. Castelle, Weise: H. Lange, Satz: A. Klaes Volkslied: Kein schöner Land in dieser Zeit Musik: Schlußmarsch
20.30 Uhr Abend für Stadt und Land
C. Karl
im Saale des Losto-Filmtheaters (Hotel Ridder) Lichtbildervortrag ,,Die gesunde Heimatlandschaft" Dipl.-Gärtner Bernhardt vom Amt für Landespflege beim Provinzialverband Münster.
Samstag, den 16. September
1950
Gedenktag der Gefallenen und Vermißten
unserer Heimat
171 Tapfere Heldensöhne aus Stadt u. Kirchspiel gaben ihr Herzblut für uns
162 Wehrmachtsvermißte einschl. Vertriebene 32 Zivilvermißte kehrten noch nicht zurück
11
8.00 Uhr: Deutsche Singmesse
für unsere gefallenen Heimatsöhne in der Katholischen Pfarrkirche
20.00 Uhr: im Saalbau Werring
Die Gefallenen unserer Heimatstadt
im Lichtbild
Uraufführung des Films der Kolpingsfamilie:
Die Kreuztragung zum Ehrenfriedhof"
Werdet Mitglieder der Interessengemeinschaft der Heimkehrer und Angehörigen der Vermißten e. V. Ortsverband
Sendenhorst
1954 - 50 Jahre Mariensäule in Sendenhorst Die Glocke, 8.12.1954 - Bernhard Fascies
Sendenhorst. Heute, am Feste Mariä Empfängnis, jährt sich zum 50. Male der Tag, an dem die
an der Südseite stehende Mariensäule eingeweiht und der Öffentlichkeit übergeben wurde. Sie bedeutet einen neuen Schmuck für den Kirchplatz  und ist eine Zierde für die Gemeinde. Sie ist zugleich
ein Zeugnis für die marianische Begeisterung unserer Bürgerschaft zu Beginn dieses Jahrhunderts.
und ist eine Zierde für die Gemeinde. Sie ist zugleich
ein Zeugnis für die marianische Begeisterung unserer Bürgerschaft zu Beginn dieses Jahrhunderts.
Unter dem 7.12.1904 brachte die Sendenhorster Lokalzeitung folgenden aufschlußreichen Bericht:
Bild:
Vor 112 Jahren noch fast wie heute: 1903 - Südlicher Kirchplatz mit Mariensäule
„Kaum sind die gnadenreichen Tage der hl. Mission dahin, die zur Erfrischung und Kräftigung des christlichen Glaubens in unserer Gemeinde beitrugen, und eine zweite herrliche Feier kann unsere
Gemeinde begehen: Die Einweihung einer prächtigen Mariensäule. Sie ist ein Werk unserer hochw. Geistlichkeit, namentlich aber des Pfarrers Beckmann. Von ihm ging der schöne Gedanke aus, der auch in
der Bürgerschaft lebhaften Anklang fand und sich in der Spendung reicher freiwilliger Gaben kundtat. Nur kurze Zeit bedurfte es zur Sammlung der notwendigen Gelder, um vor unserem würdigen
Gotteshause die Mariensäule entstehen zu lassen. Am morgigen Feste Mariä Empfängnis, jenem hochfestlichen Tage, an welchem sich 50 Jahre vollenden, seitdem die Christenheit durch die feierliche
Verkündung der Unbefleckten Empfängnis Mariens erfreut und gesegnet worden ist und der daher von den Katholiken der ganzen Welt in feierlicher Weise begangen wird, kann in unserer Gemeinde noch die
besondere Feier der Einweihung der Mariensäule vor sich gehen. Fürwahr, ein schönerer Tag konnte nicht ausgewählt werden. Das Denkmal fand in diesen Tagen manchen Bewunderer.“
Wenige Tage später, am 10.12., folgte eine ausführliche Würdigung der Mariensäule. Gefertigt wurde sie von einem Sendenhorster, dem Bildhauer Heinrich Seelige, Beckum. Die Säule hat im ganzen eine Höhe von acht Metern. Die untere Stufe ist 2,46 Meter breit, auf der sich der mittlere Bau erhebt. Letzterer trägt verschiedene Symbole; so an der Front die geistige Rose und den Morgenstern, an der rechten Seite den Turm Davids und den elfenbeinernen Turm, zur linken Seite die Arche des Bundes und die Pforte des Himmels, an der Rückseite endlich die Symbole vom Spiegel der Gerechtigkeit und dem Sitz der Weisheit. Die mittlere Tafel trägt die Inschrift: „O Maria ohne Sünden empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen.“ Die Tafel auf der Rückseite besagt: „Errichtet von der Pfarre S. am 8.12.1904 zur Erinnerung an den 50. Jahrestag der Verkündigung des Glaubenssatzes von der Unbefleckten Empfängnis Mariens.“ Auf diesem Mittelbau erheben sich in vier Nischen Figuren, darstellend die Eltern Anna und Joachim, sowie St. Bernardus und Dominikus. Ueber diesem Hauptfelde befindet sich ein Säulenbund, der die Mariensäule trägt.
Das „Scandalum“ der Sendenhorster Maria-Magdalenen-Bruderschaft Und der Schützenfestbericht des Küsters Nonhoff Anno 1733 Adolf Risse 1958
Warum Maria Magdalena, jene im Hochmittelalter so hoch verehrte und nicht nur um der
goldenen Legenden willen, sondern auch wegen ihrer von den Evangelisten erzählten Lebenswandlung von der großen Sünderin zur heiligen Büßerin beliebte Patronin der Denkmäler der Reue und der
Einrichtungen zu Fürsorge und Lebensverbesserung, der Magdalenen-Kapellen und der Maria-Magdalenen-Hospitäler, die doch seltene Auszeichnung als Namenspatronin der Sendenhorster Schützengilde erfuhr,
erklärt sich allenfalls aus einer religiös bestimmten und caritativ orientierten Tätigkeit der Sendenhorster Magdalenenbrüder.
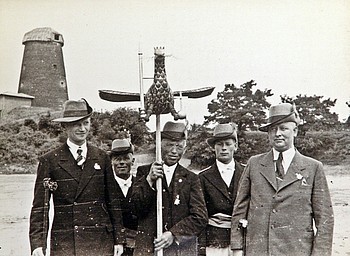
Bild:
Einer der letzten Schützenfeste - St. Martinus - vor Ausbruch des 2. Weltkrieges 1939 - Ort: Mühlenkuhle (siehe Wößmanns Mühle - Personen: Heinrich Wegmann, Wilhelm Timmes, Th. Menke, Timmes, Hermann
Overhage
Von religiösem Geist und hilfsbereiter Bestimmung können die Pfarrer zu Sendenhorst um 1700 und in den folgenden Jahrzehnten selbst bei einer sehr wohlwollenden Betrachtung nichts spüren. – Man weiß
nicht, wie alt diese Sendenhorster Schützengilde ist. Nach sicherlich schon generationslanger Vereinsgeschichte ist die Bruderschaft um 1700 ein zünftiger Schützenverein mit den möglichen Nachteilen,
aber auch mit allen Vorzügen, die ähnliche Gilden anderen Namens und fast aller Orte im Münsterland haben. Was sich in den folgenden Jahren nach 1700 zu Sendenhorst begibt, ist nichts Besonderes. Das
Alltägliche und Allgemeine erfährt hier aber seine lokale Aktualität und darüber hinaus seine allgemeine Bedeutung als Zeugnis der Zeitgeschichte, nachdem das Schießen um den Vogel und das Feiern des
Schützenkönigs dort plötzlich ins Licht der Öffentlichkeit des Münsterlandes tritt. Diese den Sendenhorstern sehr unerwünschte Publizität ihrer Schützenbräuche geht auf den moralisierenden Zeitgeist
von Behörden, Amtsstuben und Pfarrhäusern zurück, der in jenen Jahren nicht immer die Spreu von dem Weizen zu scheiden und Echtes von Unechtem, Ueberkommenes von Entartetem zu trennen wußte. Jene
ersten Mandate einer beginnenden „Aufklärung“ verboten nicht nur Osterfeuer, Lambertuslicht und Martinsabend, sondern auch Vogelschießen und Gildenfröhlichkeit. Die neue Begründung war eine
„aufgeklärte“, sie nannte nicht mehr heidnischen Unfug und Aberglauben, sondern Verschwendung von Brennmaterial, fahrlässiges Verhalten bezüglich Brandgefahr und in unserem Falle die Aufreizung zu
Sittenverderbnis im allgemeinen und zu „Exzessen in Bacho et Venere“ im besonderen. Man sah in der Umrahmung von Bierbechern und Tanzmusik nicht das Wesentliche, und man ignorierte damals beim
Vorkommen gelegentlicher Fälle, die berechtigten Klagen Anlaß geben mochten, das Volkhafte und Brauchtumsmäßige.
Mit einem solchen Standpunkt und den Anstrengungen, Zeit und Menschen in diesem Sinne zu verbessern, befaßt sich der Schriftwechsel, den eine kleine Aktenmappe mit dem Titel der Sendenhorster
Maria-Magdalenen-Bruderschaft im Diözesanarchiv zu Münster enthält. Schon dieser – in Lateinisch abgfefaßter – Schriftwechsel bietet einiges Ergötzliche. Wertvoll für die Geschichte des
heimischen Schützenwesens ist aber der Festbericht, den der Sendenhorster Küster im Deutsch jener Jahre, aber nicht in festlicher Stimmung, sondern im befohlenen Rapportstil gegeben hat. Ein älterer
lateinischer Brief des Sendenhorster Pfarrers berichtet in dieser Sache vom „Scandalum“ der Maria-Magdalenen-Bruderschaft. Und man wäre nach der Lektüre einer scharfen „Philippika“, das mit einer
Vielzahl drastischer Worte gepfeffert ist, durchaus geneigt, den Sendenhorster Magdalenenbrüdern jener Jahre alle möglichen Lausbubereien zuzutrauen, wenn man nicht aus den späteren Schriftstücken
die Harmlosigkeit aller Geschehnisse erfahren würde und das „unerhörte Scandalum“ als vergnügliches Vogelschießen mit Umtrunk und Tanz wie eine Seifenblase zerplatzen sieht.
Der in dieser Sache wider die Sendenhorster Schützen so amtseifrige Pfarrer Christophorus Bernardus Borchorst war nicht der erste Pastor, der gegen das damalige Schützenfestfeiern Sturm lief. Er
sagte in seinem Klagebrief vom Jahre 1734, daß bereits sein Vorgänger im Amte in dieser Sache tätig war. Er habe damals sogar Unannehmlichkeiten mit der Bevölkerung, ja, selbst Verfolgungen wegen der
gleichen Haltung in Kauf nehmen müssen. Es spricht ohne Zweifel für den seelsorglichen Eifer der Sendenhorster Pfarrer und für deren Pflichtbewußtsein in der Bevolgung der Mandate des Bischofs und
Landesherrn und seiner Regierung, wenn sie der Lokalluft zum Trotz und ohne Furcht vor Anfeindungen einen – wie sich später zeigen sollte – auf die Dauer doch aussichtslosen Kampf wider menschliche
Gepflogenheiten, Sitte und Brauchtum und deren damals befürchtete Entartung führten. Das erste Datum in diesem Streit um die Sendenhorster Königskürung ist nicht aktenkundig. Aber das erstmalige
Verbot des Sendenhorster Schützenfestes datiert vom 21. August des Jahres 1723. Und nicht nur das Vogelschießenfeiern, sondern auch dessen Trägerin, die doch einstmals kirchlich orientierte
Magdalenenbruderschaft, wurden untersagt.
Wie stark oder wie wenig diese Edikte wider die Sendenhorster Schützen ernst genommen wurden, erhellt wohl aus den Wiederholungen der Verordnungen. Zehn Jahre später, 1732, und dann noch einmal,
1733, kamen sie zur Verkündung. Ob man in den ersten Verbotsjahren bescheidener und zaghafter feierte und erst in den letzten Jahren jenes Dezenniums zwischen 1723 und 1733 tüchtiger „auf die Pauke“
haute, weiß man nicht. Jedenfalls ist es aus den Jahren 1731, 1732 und 1733 aktenkundig, daß die Magdalenbrüder ihre Musikinstrumente hervorholten, selbst die große Trommel mitführten, ihre Fahnen
entrollten und mit diesem Rüstzeug die Magdalenentage ihre „Festprozession“ unternahmen.
Bereits im letzten Jahre, 1733, hatte man noch rechtzeitig diese Umzüge zu verhindern versucht. Unmittelbar vor dem Magdalenentag (22. Juli) wurde das Dekret des Archidiakons vom 19. Juli 1733
publiziert. Eigentlich, so meinte man, wäre dieses Dekret überflüssig gewesen. Denn die Veranstalter hatten doch anläßlich ihrer Osterbeichte zur österlichen Kommunion schriftlich versprochen, das
Magdalenenfeiern zu unterlassen. Aus und zwischen den Zeilen der Aktennotizen mag man die Spannung herauslesen, mit der in Sendenhorst der Magdalenentag des Jahres 1733 erwartet wurde. Aber nicht nur
ein Mandat hatte man erneuert, man scheint auch der einheimischen Geschäftswelt, den Bierbrauern und Wirten, bei Androhung von Konzessionsentzug den Verkauf von „Magdalenenbier“ untersagt zu haben.
Die schlauen Sendenhorster wußten sich zu helfen. Das Bier wurde von auswärts gekauft, noch dazu von Steuergeldern. Ja, der Magistrat der Stadt, der doch von Rechts wegen Hüter der Ordnung sein
sollte, gibt sich als Protektor der Bruderschaft und spendiert das Königsbier, das Vogelschießen fand statt. Ueber diesen 22. Juli 1733 schrieb dann auf Anordnung J. H. Nonhoff, Kustos in
Sendenhorst, folgendes Protokoll: „Anno 1733, den 22. Juli, haben sich die Junggesellen lustig gemacht und auff den Rathauß getruncken auf folgende weiß:
1. Von die beyden Bürgermeisteren Johan Berndt Wieler und Ferdinandt Hölscher haben sie daß Bier bekommen.
2. Ahage sein Sohn, Johan Henrich genannt, und Bußman und Hernhuß aus steinfurt (wohl Frensteinfurt) haben mit der Musik aufgewartet.
3. auff Mariae Magdalenae Tag ohngehr umb halber fünff seindt sie zusahme von Rathauß gangen, mitt der Fahne und Trommen und Musik auff der gassen gewesen.
4. seindt sie wieder nach den Rathauß gangen und sich lustig gemacht biß zehn oder elff uhren.
5. den 23. Juli seindt sie und zwey uhren zusahmen komen mit der Fahnen und Trommen, ordentlich nach der Ostheide gangen und nach der schiebe geschossen.
6. von der Heide seindt sie wieder auff der gassen gangen und die Fahne vor deß Capiteins Hauß und Leudtmans Hauß geschlagen und nachgehenß wieder auff den Radthauß und haben sich wieder lustig
gemacht biß Eilff uhren.
7. den dritten Tag seindt sie umb eyn Uhren wieder auff den Radthauß zusahmen kommen undt mit der Fahne und Trommen undt Musick auff der gassen gegangen und wieder vor deß Capiteins und Leudtinans
Hauß wieder die Fahne geschlagen.
8. seindt sie wieder auff den Radthauß gangen, und haben sich wieder Lustig gemacht biß ohngefehr zwelff uhren.
9. seindt sie wieder von den Radthauß gangen undt den König nach Hauß gebracht.
10. Ahn der Königß Hauß seindt sie gewesen von 12 Uhren biß ohngefehr umb 3 Uhren des nachtes und haben getrunken.
11. mit der gesellschaft seindt gewesen: berndt Dirk Bonse, König, Berhardus Busman, berndt anton Ritter, Anton Harderscheidt.
12. Mägde (Ehrenjungfern wohl) seindt geweßen: Zurhorst Tochter, Ritters Magd, undt noch etliche mehr, dessen (sic!) nahme mir unbewußt ist.
J. H. Nonhoff, Custos in Sendenhorst.“
Dieser interessante Bericht besagt also u. a., daß das Sendenhorster Königsschießen kein richtiges Vogelschießen, sondern ein Scheibenschießen ist. Die große Ehre an diesen Tagen erhalten
Magistrat, Kapitän und Leutnant und erst dann der König, dem man das Heimgeleit erweist. Erst an diesem dritten Abend feiert man bis in die Nacht. Selbst der Bericht des Küsters bestätigt, daß
es „ordentlich“ zugegangen sei.
Im folgenden Jahre schreibt Pfarrer Borchorst eine Woche vor dem Magdalenentag an den Sendenhorster Archidiakon, den Freiherrn von Nagel zu Loburg in Münster. Wahrscheinlich wurde diesem Brief das
Protokoll des Küsters vom Vorjahr beigefügt. Um ein erneutes und schärferes Verbot der Bruderschaft und um ein drastisches Einschreiten gegen die „rebellischen Pfarreingesessenen“ wird gebeten.
In diesem Jahre 1734 scheint man nicht um den König geschossen zu haben. Und auch in den folgenden Jahren ist vom Trinken des Magdalenenbieres nicht die Rede.
Aber dann kam das Jahr 1736. Das kommende Magdalenenfest kündigte sich bereits zur Osterzeit und mit einer offenkundigen Sünde an. Der alte Trotz lebte wieder auf. Die Sendenhorster wendeten sich nun
ebenfalls an den Herrn Archidiakon. Sie taten es nicht ohne Erfolg. Wenigstens wurde es so erzählt. Der Pfarrer Borchorst traute – wie er schreibt – seinen Ohren nicht. Er wolle nicht glauben, daß
ausgerechnet der Archidiakon der Magdalenenbruderschaft neue Lizenz gegeben habe, ja, geradezu unglaublich, daß diese Lizenz auf ewige Zeiten in unverschämter Weise beantragt worden sei. Diesen
Antrag habe im Namen der Sendenhorster ihr Rezeptor gestellt. Ob Wahrheit an diesen Gerüchten ist, weiß man nicht. Jedenfalls wurde Anno 1736 das Magdalenenfest in alter Frische gefeiert, nicht
nur das, man beging es „wilder“ als zuvor, notiert Pfarrer Borchorst. Und selbst die Juden beiderlei Geschlechts hätten sich den Christen, den Brüdern und Schwestern der Bruderschaft, zusammengetan.
Daß die Lizenz auf ewige Zeiten nur eine Wirtshausparole war, mag man um so leichter glauben, nachdem jetzt ein neues Verbot zum Magdalenentag des Jahres 1737 aus Münster kam. Pfarrer Borchorst
erreichte mit seinem Klagebrief vom 12. Juli 1737, in dem er dem Diakon von St. Mauritz zu Münster und Promotor zu Sendenhorst, seinem einstigen Mitbruder, R. D. Farwick, seine Sorgen mitteilte, daß
bis auf weiteren Bescheid des Archidiakons der Freiherr von Nagel alle Zusammenkünfte der Magdalenenbruderschaft bei einer Strafe von jeweils einem Zentner Wachs verboten wurden. Mit dieser hohen
Strafandrohung bricht das Aktenmaterial der Sendenhorster Schützen ab.
Aus dem Jahr 1929 - Drei Schützenfeste in einer Woche
Sendenhorst, 3. Juli. Drei Schützenfeste in einer Woche. Da kann sich keiner beklagen, daß
ihm keine Gelegenheit geboten wird, fröhlich zu sein. Bild:
Schützenfest in den 1920ern - Festumzug, Westtor Einzug Stadt, Zuschauer und Begleitung
Den  Reigen dieser schönen Volksfeste eröffnete am Montag die
altehrwürdige Johannesbruderschaft. Es scheinst fast sprichwörtlich geworden zu sein, daß die „Jansbröers“ mit dem Regen beglückt werden, wenn sie nach dem Gottesdienste und dem Frühstück zum
Festplatz marschieren.
Reigen dieser schönen Volksfeste eröffnete am Montag die
altehrwürdige Johannesbruderschaft. Es scheinst fast sprichwörtlich geworden zu sein, daß die „Jansbröers“ mit dem Regen beglückt werden, wenn sie nach dem Gottesdienste und dem Frühstück zum
Festplatz marschieren.
Nichtsdestoweniger war das Leben und Treiben in der Mühlenkuhle frei von Griesgram und Sorgen des Alltags. Und auch der Himmel machte bald ein freundliches Gesicht. Den Königsschuß tat der
Schützenbruder Karl Saerbeck, der sich nach alter Sitte seine Ehefrau zur Königin wählte. Des Nachmittags kämpften die Damen in einer lebhaften Kaffeeschlacht. Der Fahnenschlag ist bei den Jansbröers
nicht üblich. Der neue Fähnrich, der sich darin üben wollte, hatte aber das Mißgeschick, daß ihm dabei die Stange zerbrach. In den Abendstunden fanden sich die Schützenfamilien wiederum im Festsaale
zusammen, um nach alter schöner Art Stunden des Frohsinns und der Gemütlichkeit zu verleben.
Daß die Freude die beste Medizin ist, weiß auch der Hausarzt des hiesigen Krankenhauses. Und so sollte auch allen Kranken durch ein Schützenfest diese Medizin gereicht werden. Am Dienstag feierte nun
das ganze Krankenhaus mit seinen über 300 Bewohnern sein erstes Schützenfest in seinem 40jährigen Bestehen. Mancher mag über diese Idee den Kopf geschüttelt haben. Aber, wenn der Stifter des Hauses,
der selige Spithöver, noch lebte, würde er sicher von Rom herübergekommen sein, hätte an dem Feste teilgenommen und Fahne und Königskette gestiftet. Die Anlagen des St. Joseph-Stiftes waren festlich
geschmückt. Nach dem Gottesdienst gab es auch hier Töttchen. Ein langer Festzug mit dem berittenen Obersten an der Spitze bewegte sich wiederholt durch die prächtigen Anlagen. Die nicht marschfähigen
Kranken schauten vom Bette aus dem frohen Treiben zu, bewunderten den Fahnenschlag von Meister Börger, lauschten auf die Klänge der Musik und die launigen Worte der Festredner. Ein junger Mann aus
Sende schoß den Vogel ab und verdiente sich dadurch als Andenken ein Sparkassenbuch mit einer Einlage von 50 M, das ihm der Bürgermeister der Stadt Sendenhorst aushändigte. Die Sterne kamen schon an
den Himmel, als allmählich die Freudenklänge verstummten. Als am folgenden Morgen die Großen und Kleinen die Augen öffneten, fragten sich viele, ob es Traum oder Wirklichkeit gewesen sei, was sie
gesehen und mitgemacht. Alle fühlten sich gestärkt und gebessert von der vortrefflichen Medizin, die ihnen der fachkundige Hausarzt verschrieben.
Am Sonntag und Montag feiert nun der Allgemeine Schützenverein sein diesjähriges Fest. Nach den Vorbereitungen zu rechnen, wird auch dieses Fest unter seinem neuen Präses unter allgemeiner Teilnahme
wieder schön verlaufen.
+ Sendenhorst, 4. Juli. Gestern nachmittag wurde der Arbeiter Fritz Obernostheide in seinem Bette erhängt aufgefunden. Der Unglückliche litt seit langer Zeit an Schwermut. Er glaubte, das Erdendasein
nicht mehr ertragen zu können.
Der Münzschatz von Sendenhorst - Ein trauriges Kapitel der Heimatgeschichte
Am 30. November 1932, also vor genau 20 Jahren, wurde bei Sendenhorst in der Bauerschaft Bracht ein bedeutender Münzschatz gehoben. Ehrenvoll hätte er den Namen der Stadt Sendenhorst in alle Lande tragen und die deutsche Münzforschung einen großen Schritt voran und den Findern eine gute Belohnung bringen können.
Bild:
Ahlener Damm in Richtung Sendenhorst im Jahr 2014 - Hier befindet sich das Steinkühlerfeld.
Damit ist allerdings kein einzelnes Feld gemeint, sondern das gesamte Areal.
Doch was damals geschah, ist heute schon Geschichte, und doch ist es erforderlich anläßlich seiner Auffindung vor 20 Jahren, das damals unrichtige Verhalten der Finder und das traurige Schicksal des
Fundes als Mahnung aufzuzeigen.
Was die alte Sage erzählt
In der Bauerschaft Bracht fragte vor vielen hundert Jahren ein Reiter einen pflügenden Bauern nach dem Wege. Dabei faßte der Reiter nach seinem Felleisen, das er hinter sich auf seinem Pferde
angeschnallt hatte, denn darin verwahrte er sein Geld, da er im Münsterlande große Verkäufe getätigt hatte. Nachdem er Bescheid erhalten, ritt er nach kurzem Gruß weiter. Der ihm nachblickende Bauer
sah, daß vom Rücken des Pferdes der pralle Geldsack fiel, und er lief schnell hin, ihn aufzunehmen, sobald der Reiter hinter einer Wegebiegung verschwunden war. Als er das viele Geld darin sah, kam
ihm ein teuflischer Gedanke. Schnell verbarg er das Felleisen und pflügte weiter, als wenn nichts geschehen sei, denn schon bald kam der Reiter, der seinen Verlust bemerkt hatte, zurück. Vergeblich
hatte er den Weg nach seinem Eigentum abgesucht, und er fragte den Bauern, ob er das Felleisen gefunden habe. Der Bauer verneinte, und als der Reiter ihm direkt auf den Kopf zusagte, daß er ihn
gefunden haben müsse, da er ihn noch gefühlt habe, als er nach dem Wege fragte, schwor der Bauer bei allen Heiligen, daß er nichts gefunden oder gesehen habe. Da stieß der reisende Kaufmann , denn um
einen solchen handelte es sich bei dem Reiter, einen grauenhaften Fluch aus und verwünschte den Bauern, seine ganze Familie und den Hof mit allem, was zu ihm gehöre. Dann ritt er fluchtartig davon,
als sei der Acker, auf dem der Bauer stand, voll Pech und Schwefel, als habe da der leibhaftige Satan sein Reich.
Den Bauern, so stur und abgebrüht er auch war, durchfuhr ein eisiger Schreck. Zwar holte er den Geldsack aus dem Versteck hervor, als der Reiter schon Stunden fort war, betrachtete auch die vielen
großen und kleinen Silber- und Goldmünzen, doch traute er sich nicht, den Schatz mit nach Hause zu nehmen. Keinem Menschen, nicht mal seiner Frau, sagte er etwas davon. Wohl schlich er sich von Zeit
zu Zeit hin und betrachtete ihn immer wieder, doch wagte er nicht, auch nur eine der Münzen auszugeben.
Gar bald kam ein Unglück nach dem andern über den Hof, seine Familie und ihn selbst. Sichtbar erfüllte sich der Fluch des Reiters, und von Schrecken erfüllt schüttete er eines Nachts die Münzen in
zwei Tongefäße und vergrub sie in einer verlassenen Steinkuhle. Doch auch das half ihm nichts, denn der Satan holte ihn, der Hof verfiel und mußte verkauft werden, und die Nachbarn flüsterten scheu
von der unseligen Tat, und die Sage davon und von dem verborgenen Schatz trug sich von Mund zu Mund, von Generation zu Generation durch die Jahrhunderte.
Noch mehr Sagen und Geschichten sind im aktuellen StadtLand-Magazin zu finden..
Der Schatz wird gefunden
Im November 1932 ließ der Bauer Große-Kogge eine alte Steinkuhle zufüllen, einebnen und zu einem Acker machen. Dabei fanden am 30. November die Arbeiter zwei größere Tongefäße, die bis obenhin mit
Silbermünzen angefüllt waren. In dicken Klumpen waren die zusammenoxydiert, und man konnte noch genau erkennen, daß sie der Größe nach in Rollen in Leinenläppchen verpackt gewesen waren, als
man sie in die Krüge steckte, ehe man sie der Erde übergeben hatte.
Als sich auch Goldstücke unter den Münzen zeigten, bewog der Hauptfinder und Rädelsführer die anderen, nichts von dem Schatz zu sagen und ihn zu teilen, wobei er natürlich den Hauptanteil erhielt.
Ueber den wirklichen Umfang des Fundes sollte niemand etwas erfahren.
So geschah es dann auch. Und als die Auffindung der Münzen doch ruchbar wurde, da erzählte man, es seien nur 382 Münzen gewesen, die man in einem Gefäß gefunden habe. So stand es auch am
6. Dezember 1932 in der „Glocke am Sonntag“ unter dem Bilde, das drei der Finder mit Teilen des Fundes zeigte. Der Besitzer des Grundes ließ sich auch täuschen und gab sich mit einem Bruchteil
des angeblichen Fundes zufrieden.
Nun glaubten sich die Finder im Recht, hielten dicht und verkauften und verhandelten die Münzen in alle Welt, nach Frankfurt a. M., Münster, Amsterdam und anderen Orten. Ein Finder verkaufte allein
500 Münzen an einen Händler, und bald wußten Sammler und Münzwissenschaftler besser über den Fund Bescheid als irgendein Sendenhorster Bürger oder gar die Finder selber.
Den Hauptteil der Münzen aber hatte man einem übel beleumdeten Mann aus Soest übergeben und damit den Bock zum Gärtner gemacht. Schon bald war den Findern gesagt worden, daß sie es falsch gemacht
hätten, daß sie einem Gauner in die Finger gefallen seien und daß nunmehr auf sie das Sprichwort „Wie gewonnen – so zerronnen“ seine Anwendung finden würde.
So ist es auch gekommen. Den Findern brachte der von ihnen unterschlagene Fund nicht den erhofften Reichtum. Der Herr aus Soest hatte auch keinen Segen davon und starb bald. Was aus dem Nachlaß für
die Finder heraussprang, wurde für rückständige Schulden festgehalten.
So sah der Münzschatz aus
In zwei mittelalterlichen Gefäßen, gelblich-weißen, mit rötlichen Flecken versehenen Tonkrügen, die im 14. und 15. Jahrhundert zahlreich in Siegburg bei Köln hergestellt wurden, hatte man die Münzen
gefunden. Einer war sofort bei der Auffindung entzwei gegangen, dem anderen hatte man den Hals abgeschlagen, um die Münzen herausschütten zu können. Die Gefäße wurden kaum geachtet, gelangten aber in
sichere Obhut und werden heute noch aufbewahrt mit einigen anderen Münzschatzgefäßen. Die in alle Welt zerstreuten Münzen aber sind auch in den vergangenen 20 Jahren nicht wieder herbeigeschafft
worden. Das wäre ja auch ein unsinniges Unterfangen gewesen, denn etwa 5000 bis 6000 (fünf- bis sechstausend) Münzen müssen in den beiden Gefäßen gewesen sein. Aber es wurde schriftlich viel von den
verschollenen Münzen zusammengetragen, und es wird möglich sein, den Fund in groben Umrissen zu rekonstruieren.
Aus talergroßen bis linsenkleinen Münzen setzte sich der Fund zusammen. Viele Seltenheiten waren darunter, und manche Münze wußte mehr zu erzählen, als ein großes Pergament. Große Bereicherung erfuhr
die Münzwissenschaft trotzdem, aber viel, viel Arbeit hätte erspart werden können, wenn die Finder so gehandelt hätten, wie es das Gewissen und das Gesetz vorschreiben: Binnen drei Tagen der
Ortspolizeibehörde anmelden. Der Wert des Fundes gehört dann zur Hälfte dem Finder, die andere Hälfte dem Grundeigentümer. Ein gutes Stück Geld hätte jeder Finder erhalten, wenn er dem nächsten
Museum oder dem Landesmuseum in Münster Mitteilung von dem Funde gemacht hätte. Gerade Münster hätte das größte Interesse an dem Fund gehabt, denn es waren sehr viele Stücke darunter, die man in der
Stadt Münster mit einem oder zwei Gegenstempeln versehen hatte, das heißt, man hatte den Kopf des hl. Paulus in die Münzen geschlagen und sie so kenntlich gemacht, daß sie vor 500 Jahren im
Münsterland als kursfähige Münzen umlaufen konnten. Viele Münzen kamen nämlich von weither. Aus dem Raume Nieder- und Obersachsen waren Münzen aus den Prägestätten: Bremen, Stade, Hildesheim,
Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Anklam, Friedland, Gnoien (Mecklenburg), Greifswald, Güstrow, Rostock, Stettin, Treptow, Wismar und Wolgast. Aus Rheinland-Westfalen enthielt der Fund Stücke aus Aachen,
Jülich, Berg, Kleve, Heinsberg, Mörs, Köln und Trier. Besonders zahlreich waren aus der Grafschaft Mark die Prägestätten: Hamm, Hattingen, Hörde, Brekerfeld, Schwerte und Unna; aus der Grafschaft
Limburg: Broich bei Mülheim, Rellinghausen bei Essen und Hohenlimburg an der Lenne mit Groschen, Pfennigen, Hälblingen und Vierlingen vertreten.
Sehr zahlreich waren aber auch die großen Doppelgroschen und Groschen aus den Niederlanden, von Brabant, Flandern, Hennegau, Holland, Lüttich und Utrecht sowie auch Münzen von Frankreich, Schottland
und Polen im Funde.
Ja, ein wirklich trauriges Geschick hatte der große, leider berüchtigt, aber nicht berühmt gewordene Münzschatz von Sendenhorst, über den man ein dickes Buch hätte schreiben können. Wenn heute nach
20 Jahren daran erinnert wird, dann nur darum, damit so etwas nie wieder vorkommt. Jedermann muss wissen, daß selbst eine einzelne Münze, die in der Erde gefunden wird, für die Heimatforschung und
Wissenschaft von Interesse sein kann, so daß man auch den kleinsten Fund anmelden sollte. Ganz besonders gilt dies aber von den Schatzfunden, von den in Gefäßen oder sonstigen Behältern der Erde
anvertrauten Münzen. Das Eigentumsrecht ist in jedem Falle gesichert. Es ist aber wichtig, daß der Finder seinen Fund niemals selbst reinigt! Das muß sachkundigen Händen vorbehalten bleiben, denn nur
zu oft zeigt nur noch die Grünspanschicht das Gepräge. Also Finger weg von den Bodenfunden, möglichst sofortige Anmeldung, zu eigenem und der Heimat Nutzen.



